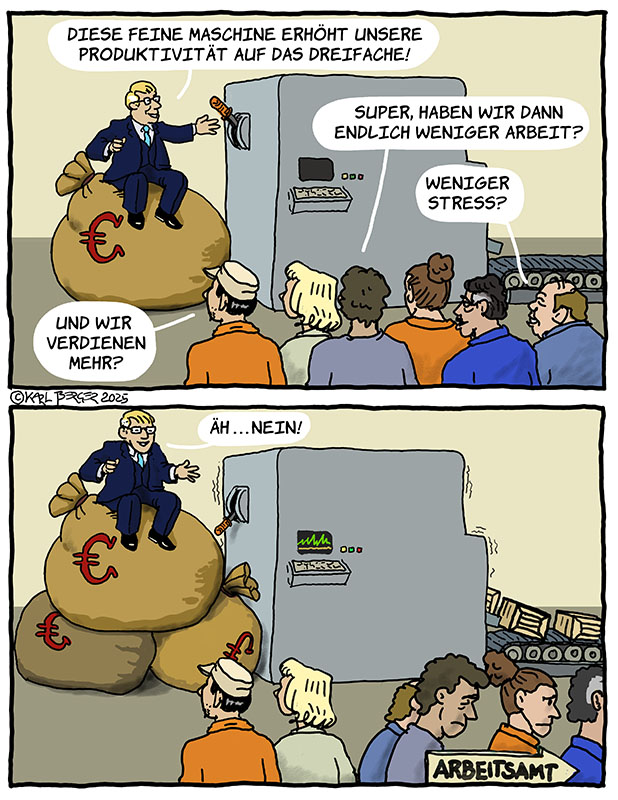Hier können Sie die AI-generierte Audioversion dieses Artikels anhören.
Was ist die Folge, wenn in der Medizin fast nur an Männerkörpern geforscht, entwickelt und therapiert wird? Medikamente, die nicht wirken, Diagnosen, die zu spät kommen, Schmerzen, die nicht ernst genommen werden. Als Gynäkologin sehe ich täglich, wie sich diese strukturelle Schieflage auf das Leben von Frauen auswirkt. Und es beginnt schon ganz am Anfang – in der Petrischale.
Neun von zehn Arzneimittel-Studien starten mit männlichen Zellen. Selbst bei Tierversuchen wird oft der weibliche Zyklus umgangen. Warum? Weil er „kompliziert“ ist. Dabei ist längst bekannt, dass Zellen je nach Geschlecht unterschiedlich reagieren. Ein Beispiel: In einer Studie wurde herausgefunden, dass nur weibliche Stammzellen die Muskelregeneration förderten – männliche nicht. Wird das bei Tests übersehen, endet die Forschung oft frühzeitig. Therapien, die Frauen helfen könnten, verschwinden in der Versuchsreihe weil sie auf männliche Zellen nicht wirken.
Noch bis 1993 war es in den USA gesetzlich verboten, Frauen im gebärfähigen Alter in Medikamentenstudien einzubeziehen – eine Reaktion auf den Contergan-Skandal. Seitdem ist ihre Teilnahme nur bei öffentlich geförderten Studien vorgeschrieben, nicht aber bei jenen, die von Pharmafirmen finanziert werden. Das Ergebnis:
Lediglich 12 Prozent der Studien zu frauenspezifischen Erkrankungen werden tatsächlich an Frauen durchgeführt. Auch bei medizintechnischen Geräten ist die Lage alarmierend – nur vier Prozent der Studien werten Ergebnisse geschlechtsspezifisch aus.
Medikamente wirken schlechter oder gar nicht, Dosierungen sind nicht an Frauen angepasst
Diese Forschungslücken bei Medikamenten haben Folgen. Frauen leiden 53 Prozent häufiger an Nebenwirkungen, zweithäufigste Nebenwirkung ist, dass das Medikament nicht wirkt. Frauen bekommen dieselben Dosen wie Männer verschrieben, obwohl ihr Körper Medikamente anders aufnimmt, anders verarbeitet und länger im System behält. Trotzdem gelten weiterhin „Standarddosierungen“. Allesamt ausgelegt auf den jungen, gesunden, weißen 80-Kilo-Mann – Standard eben.
Selbst beim Thema Schmerz werden Frauen benachteiligt. Sie erhalten seltener Schmerzmittel, warten laut Studien in Notaufnahmen 30min länger darauf und wie im Fall von Ibuprofen wirken sie schlechter. Absurderweise wird gerade dieses Medikament groß zur Behandlung von Menstruationsbeschwerden vermarktet. Es gibt auch die Gefahr eines „zu viel“: Nach Operationen benötigen Frauen ein Drittel weniger Morphin zur Schmerzlinderung – doch die angewandte Dosis bleibt oft gleich. Das erhöht das Risiko einer Überdosierung.
Ein anderer Wirkstoff, Sildenafil (besser bekannt als Viagra), zeigte in Studien großes Potenzial bei Menstruationsschmerzen. Vier Stunden Schmerzfreiheit, keine Nebenwirkungen. Doch Folgeforschung? Abgelehnt. Die Autoren dieser Studie haben erfolglos mehrfach um weitere Forschungsförderung angesucht. Doch die Forschung wurde nicht als Priorität gesehen.
Das Ergebnis all dessen nennt man Gender Pain Gap: Frauen haben häufiger Schmerzen, werden nicht wahrgenommen in ihren Schmerzen und werden schlechter oder gar nicht therapiert.
Autismus, Herzinfarkte – bei Mädchen und Frauen schaut man nicht gut genug hin
Dass Frauen in der medizinischen Praxis schlechter abschneiden, liegt nicht nur an Medikamenten. Viele Diagnosen orientieren sich am männlichen Krankheitsbild. Ich selbst habe noch auf der Uni gelernt: Autismus kommt bei Buben vier Mal häufiger vor als bei Mädchen – stimmt nicht! Autismus äußert sich nur bei Mädchen ganz anders. Mädchen sind anders sozialisiert und diese Sozialisierung führt dazu, dass sie sich im Alltag stärker an soziale Erwartungen anpassen und sie daher weniger auffallen. Diagnosekriterien wurden aber fast ausschließlich aufgrund von Forschung an Buben erstellt, deshalb wird Autismus bei Mädchen häufig nicht diagnostiziert.
Herzinfarkte sind ein weiteres Beispiel: Junge Frauen sterben doppelt so häufig wie Männer desselben Alters, weil ihre Symptome als „atypisch“ gelten. Herzinfarkte bei Frauen verlaufen nicht nur anders, sie werden auch seltener erkannt. Frauen werden weniger häufig reanimiert, seltener ins Spital gebracht, seltener untersucht und behandelt. Die Reanimation ist weniger oft erfolgreich, weil Reanimationen hauptsächlich an männlichen Puppen ohne Busen geübt werden. 18 % weniger häufig werden Frauen nach einem Herzstillstand auf eine Intensivstation aufgenommen. Ihr Sterberisiko ist damit deutlich höher. Kardiovaskuläre Erkrankungen sind bei Frauen Todesursache Nr. 1.
Das ist ein Ansatzpunkt, wo wir wirklich daran arbeiten müssen, Männer und Frauen gleich zu behandeln. Die Symptome von Frauen bei Herzinfarkten werden als atypisch bezeichnet. Sie sind nicht atypisch. Wir sind 50 % der Bevölkerung!
Oft würde es in der Medizin schon reichen, Patientinnen ernst zu nehmen und zuzuhören
Bei Endometriose, einer chronischen Erkrankung mit starken Schmerzen, warten betroffene Frauen durchschnittlich acht Jahre auf eine Diagnose, auch in Österreich. Die wichtigste Empfehlung in der 2017 erstmals erstellten Leitlinie ist bezeichnend: den betroffenen Frauen zuhören. Etwas, das in der Realität oft untergeht. Eine Frau berichtet über Bauchschmerzen? Dann soll sie halt ein paar Tabletten nehmen. Die Regelschmerzen sind stark? Naja, da muss man halt durch… Doch wer genau zuhört, wenn Betroffene ihre Beschwerden beschreiben, erkennt, dass es sich um Endometriose handeln könnte. Eine Krankheit, unter der übrigens jede 10. Frau leidet, wie man jetzt weiß.

Dass Schmerzen einfach als Frauenschicksal gelten, das sie ertragen sollen, erkennt man auch daran, dass es erst seit wenigen Monaten (!) eine Empfehlung gibt, Mädchen und Frauen Schmerzmittel anzubieten, bevor man ihnen eine Spirale zur Empfängnisverhütung einsetzt. Sehr spät und das, obwohl in einer rezenten Studie 78 Prozent der Patientinnen von mäßigen bis starken Schmerzen beim Einsetzen berichtet haben. Auch bei Proben die aus dem Gebärmutterhals „geknipst“ werden, um Zellveränderungen zu untersuchen, gibt es standardmäßig keinerlei Betäubung vorab.
Eine Schwangerschaft kostet in Österreich 2.800 Euro
Auch die Finanzierung zeigt, wie sehr Frauen allein gelassen werden. Eine Schwangerschaft kostet in Österreich rund 2.800 Euro – und da geht es nicht um die Babyausstattung. Viele Untersuchungen – z.B. Ultraschalle – empfohlene Vitamine, Impfungen, Vorbereitungskurse, Pränataldiagnostik… das alles ist meist selbst zu bezahlen. Wenn Stillen nicht möglich ist, kommen schnell Kosten für Stillberatung hinzu oder, falls das keine Option ist, etwa 100 Euro monatlich für Milchpulver.
Nachteiler auch bei künstlicher Befruchtung: Zugang zu finanzieller Hilfe bei IVF ist für Männer leichter als für Frauen
Wer beim IVF-Fonds um finanzielle Unterstützung ansucht, muss Voraussetzungen erfüllen, sprich: belegen, dass man medizinische Hilfe braucht. Bei mehr als der Hälfte der vom Fonds bewilligten IVF-Versuche (58,1 Prozent) liegt der Grund ausschließlich beim Mann. 12,6 Prozent der Fertilisationsversuche werden durchgeführt, weil die Frau einen Grund aus dem Kriterienkatalog erfüllt. Beim Rest – 29,3 Prozent – liegen bei beiden Geschlechtern Indikationen vor und werden vom IVF-Fonds gefördert.
Woher kommt die ungleiche Verteilung? Weil die Hürden für Frauen größer sind, zu zeigen, dass sie eine Indikation haben. Beim IVF-Fonds müssen Frauen in den allermeisten Fällen OP-Berichte vorlegen, um Unterstützung zu erhalten. Bei Männern genügt ein auffälliges Spermiogramm.
Von Männern operiert zu werden, birgt für Frauen höheres Risiko, an der OP zu sterben
Gehen wir nun ins Krankenhaus, konkret in den Operationssaal. Es gibt eine Zahl, die in der Medizin vor drei Jahren durch die Decke gegangen ist: In einer groß angelegten Studie hat man die Behandlungsdaten von 1,3 Millionen Menschen in Kanada retrospektiv ausgewertet. Es ging und die Frage der Komplikationen und Überlebenschancen nach Operationen. Heraus kam: Frauen, die von Männern operiert wurden, hatten ein um 32 Prozent höheres Risiko, an der OP zu sterben. Bei weiblichen Operateurinnen gab es keinen Unterschied. Das Geschlecht der operierenden Fachkraft entscheidet also maßgeblich über die Überlebenschancen von Frauen.
Warum das so ist? Die Studienautor*innen vermuten gesellschaftliche Prägungen (also unbewusste Vorurteile gegenüber weiblichen Patientinnen am OP Tisch), unterschiedliche Arbeitsstile sowie ein anderer Umgang mit unerwarteten Situationen, die während einer OP auftreten. Umgekehrt fühlen sich Ärztinnen in OP-Situationen mit Vorurteilen konfrontiert und dadurch strenger beurteilt – was zu anderem Verhalten und anderen Entscheidungen während einer OP führt.
Der Gastbeitrag basiert auf der Keynote von Mirijam Hall beim Barbara Prammer Symposium 2026 in Wien.
Geburt ist immer noch ein Risiko für Frauen
Alle zwei Minuten stirbt eine Frau an Komplikationen während Schwangerschaft oder Geburt. Das macht pro Jahr 260.000 Todesfälle. 70 % davon finden in den Sub Sahara Staaten statt, einfach aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung. Rund um die Geburt ist Blutverlust immer ein großes Thema – zum Beispiel bei einem notwendigen Kaiserschnitt.
Was wäre, wenn man ein Medikament hätte, das Wehen verstärken und Blutungen verhindern kann? Tatsächlich gibt es dieses Medikament, es heißt Oxytocin. Das Problem ist nur: Oxytocin wirkt bei vielen Frauen nicht gut genug. Es hat eine Studie gegeben, die gezeigt hat, dass, wenn man den PH-Wert von der Frau vorher ansteuert, dieses Oxytocin plötzlich bei 90 % der Frauen wirken kann.
Es hätte danach weitere Studien gebraucht, um diesen Effekt zu bestätigen und um die Vorgehensweise dann in die Praxis zu bekommen. Das British Medical Research Council hat das abgelehnt. Es gibt nicht ausreichend Priorität für dieses Thema.
Gleichberechtigung für Patientinnen, Forscherinnen und Ärztinnen ist machbar – und dringend notwendig
Die Medizin wurde über Jahrhunderte auf Männer ausgerichtet. Sie galten – und gelten – als Norm, Frauen als Abweichung. Diese Perspektive wirkt bis heute – in Lehrbüchern, in OP-Sälen, in Forschungsanträgen, in Publikationen, in der Medikamenten-Entwicklung.
Das Gute ist: Es muss nicht so bleiben. Denn alles, was gemacht ist, kann man auch ändern!
Mirijam Hall ist Gynäkologin, Vorsitzende der Aidshife Wien und Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung.
Von Crash-Dummies bis zur Zahnpasta: Wo Frauen in der Forschung jahrelang übersehen wurden