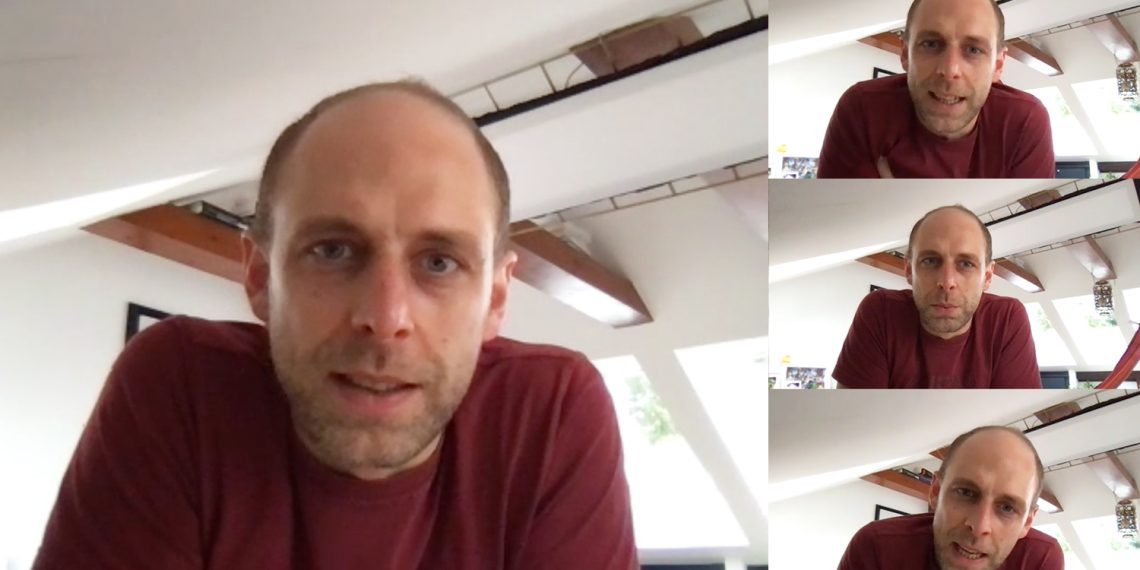Der Linzer Sozioökonom Jakob Kapeller hat mit seinem Institut an der JKU (Johannes Kepler Universität) Linz das Vermögen der Reichsten in Österreich untersucht. Das Ergebnis: Das reichste Prozent besitzt 39% der Vermögen in Österreich, die Ungleichheit ist deutlich größer als bisher bekannt. „Was die Ungleichheit betrifft, bewegen wir uns tendenziell wieder in Richtung der 1910er Jahre“, sagt der Ökonom im Interview.
Das bringt viele Probleme mit sich: Eine geringe Kaufkraft der Massen, die hohe Instabilität am Finanzmarkt und einen schlechteren Gesundheitszustand der Bevölkerung. Kapeller hat sich unterschiedliche Modelle von Vermögenssteuern angesehen und meint: Wenn wir den einen klimapolitischen Strukturwandel wollen, können Vermögenssteuern einen wesentlichen Beitrag leisten.
Das Vermögen in Österreich ist laut der Vermögensstudie der JKU Linz deutlich ungleicher verteilt als bisher bekannt. Warum weiß man so wenig über das private Vermögen in Österreich?
Kapeller: Es gab lange Zeit keine systematische Datenerhebung zum privaten Vermögen in Österreich – wie auch in vielen anderen Ländern. Wir wussten daher wenig über die Größe der Vermögen und deren Verteilung. Erst durch die Initiative der EZB, eine eigene Befragung zu diesem Thema zu organisieren, ist es gelungen, einigermaßen vergleichbare und verlässliche Daten für die meisten europäischen Länder zu erstellen.
Aber der Fokus auf Vermögen und Ungleichheit kommt sehr spät. Man kann sich schon fragen: Warum ist man über viele Jahre davon ausgegangen, dass man über so eine zentrale Größe so wenig wissen muss?
Das kann man natürlich als eine politische Entscheidung lesen – wobei auch die ökonomische Wissenschaft beim Thema Verteilung lange eher schweigsam war und sich erst in den letzten beiden Jahrzehnten wieder stärker zum Thema äußert. Einige Länder verfügen auch über Steuerdaten zu privatem Vermögen, aber diese sind typischerweise lückenhaft und eben nur für ausgewählte Länder verfügbar. Also sind die Befragungsdaten, die seit zehn Jahren von der EZB und in Österreich von der Österreichischen Nationalbank erhoben werden, die einzige verfügbare Datenquelle, um mehr über das Vermögen zu erfahren. Diese Daten der Nationalbank sind ein Quantensprung in unserer Erkenntnis über das Vermögen der privaten Haushalte in Österreich.
Und was sieht man in den Daten zum Vermögen?
Kapeller: In den meisten Ländern Europas ist das Vermögen ungleicher verteilt als man vielleicht annehmen würde.
Für Österreich haben wir festgestellt, dass das Vermögen im europäischen Vergleich noch einmal besonders ungleich verteilt ist. Das reichste Prozent der privaten Haushalte hat 39 Prozent der gesamten Vermögen. Im Vergleich dazu hat die gesamte untere Hälfte der Vermögensverteilung nur rund 3 Prozent des gesamten Vermögens.
Vermögen ist extrem ungleich verteilt – viel ungleicher auch als Einkommen.
Wie hat sich die Ungleichheit in Österreich entwickelt?
Kapeller: Wir haben in Österreich vor Beginn des ersten Weltkriegs in einer Welt mit extrem hoher Vermögenskonzentration und großer Ungleichheit gelebt. Das reichste Prozent der Bevölkerung besaß damals die Hälfte des Vermögens (heute 39%, Anm.), die obersten zehn Prozent 90 Prozent der Vermögen (heute ca. 66%, Anm.). Dies hat sich durch die Kriege und Krisen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und durch die Durchsetzung gewerkschaftlicher Rechte und des Wohlfahrtsstaates in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die 1970er Jahre stark verändert. Die Vermögenskonzentration war im historischen Vergleich in dieser Phase etwas niedriger, auch weil es nach dem zweiten Weltkrieg erstmals in der Geschichte für die breite Masse der Bevölkerung möglich war, als abhängig Beschäftigte ein kleines Vermögen aufzubauen. Die These, dass man durch die eigene Arbeit zu einem Vermögen kommt, stimmt ja für einen großen Teil unserer Geschichte nicht, aber nach dem zweiten Weltkrieg hat es für zwei bis drei Jahrzehnte ganz gut gepasst. Seit 1980 nimmt die Vermögenskonzentration dann wieder zu. Was die Ungleichheit betrifft, bewegen wir uns daher wieder einigermaßen zügig in Richtung der 1910er Jahre.
Man kann sich diese Entwicklung im 20. Jahrhundert graphisch als ein „U“ vorstellen: Das 20. Jahrhundert beginnt mit hoher Ungleichheit, die nimmt dann ab und steigt in den letzten 40 Jahren wieder an. Die Ursachen sind entscheidende Trendwenden wie die Globalisierung, der Aufstieg des Finanzmarktkapitalismus und die Schwächung der Gewerkschaften. Dadurch ist die Vermögensungleichheit wieder gestiegen, und zwar in Richtung der uns bekannten historischen Höchststände.
Weiß man auch, woher dieses Vermögen kommt? Stammt das aus Erbschaften, Start-Ups oder aus Spekulationsgewinnen?
Kapeller: Je größer das Vermögen ist, umso größer ist auch die Bedeutung von Erbschaften für dieses Vermögen. Ein zufälliger Haushalt aus den oberen 10 Prozent hat mit wesentlich größerer Wahrscheinlichkeit eine relevante Summe geerbt als bei den unteren 50 Prozent. Da sehen wir schon, dass sich die Vermögensungleichheit über die Generationen hinweg verstärkt.
Für viele Haushalte am oberen Rand der Vermögensverteilung ist die Erbschaft die zentrale Quelle des Vermögens. Theoretisch ist natürlich auch möglich, aus eigener Kraft Vermögen zu erwerben – aber in den Daten ist das nur eine sehr kleine Gruppe.
Die untere Hälfte hat überhaupt kein nennenswertes Vermögen, da besteht das Vermögen aus so Dingen wie dem Auto. Beim Mittelstand bis zu den oberen 15 bis 20 Prozent besteht das Vermögen vor allem in der Wohnimmobilie, also auch dort ist das Nettovermögen noch recht klein. In den oberen 10 bis 5 Prozent nimmt der Finanzbesitz stark zu, also die haben ihr Vermögen in Form von Aktien und Anleihen oder auch in Firmenvermögen. Finanz- und Firmenvermögen sind ganz stark an der Spitze konzentriert.
Die Unterschiede werden nach oben hin immer größer…
Kapeller: Je weiter man nach oben schaut, umso beeindruckender werden die Unterschiede. Die untere Hälfte hat weniger als 80.000 Euro Vermögen. Der Mittelstand mit einer Wohnimmobilie hat dann zwischen 150.000 bis 300.000 Euro im Schnitt, wenn man die Schulden abzieht. Das heißt, der Mittelstand hat das doppelte oder dreifache der unteren Hälfe. Ganz oben gibt es dann aber eine extreme Ballung: Der durchschnittliche Haushalt im reichsten Prozent der Vermögensverteilung hat 12,5 Mio. Euro. Das ist eine ganz andere Dimension als der Rest. Und dann kommen noch die Allerreichsten dazu, die im Milliardenbereich liegen – die haben dann wieder das 50-fache oder 100-fache der 12 Millionen. Das kann man sich dann eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil wir Menschen es nicht gewohnt sind, in solchen Größenordnungen zu denken.
Sind diese enormen Vermögen dann noch mit so etwas wie Leistung verbunden?
Kapeller: Das ist letztlich vor allem eine philosophische Frage. Grundsätzlich leben wir in einer Kultur und Gesellschaft, die Leistung tendenziell mit dem Einkommen gleichsetzt. So steht es auch im Ökonomie-Lehrbuch, das ist die Natur des dort beschriebenen Wettbewerbs: Wenn alles so läuft wie im idealen Modell, kriegt jeder und jede genau das, was er oder sie verdient. Aber man kann auch fragen: Wo ist die Leistung dahinter, wenn jemand über Nacht in seinem Portfolio 15 Prozent Plus macht, weil der Bitcoin aufgrund von Spekulationen steigt. Im Vergleich zur Krankenschwester, die in der gleichen Nacht im Dienst ist und im Monat unter Umständen nur die Hälfte dessen verdient, was der Spekulant nächtens an Gewinn eingestreift hat.
Wenn wir also sagen, dass Einkommen die Leistung misst, dann ist das eine normative Setzung. Was Leistung im Sinne eines wertvollen Beitrags für die Gesellschaft ist, wird nicht unbedingt am Markt widergespiegelt. Die generelle Frage, wie wir Leistung entschädigen und was eine faire Entschädigung für unterschiedliche Berufsgruppen ist – das ist eine politische Frage. Man kann Leistung hier letztlich nicht rein wertneutral definieren.
Ist es überhaupt wichtig zu wissen, was die Reichsten besitzen? Kann das dem Rest von uns nicht auch egal sein?
Kapeller: Ganz persönlich und lebenspraktisch kann es uns wirklich egal sein. Es ist nie emotional gesund, darüber nachzudenken, was die anderen haben oder haben könnten. Man soll seine Zeit mit besseren Dingen verbringen.
Wissenschaftlich müssen wir darüber aber nachdenken, weil wir aus der Geschichte wissen, dass Vermögenswachstum und steigende Vermögenskonzentration dazu tendieren, stabile soziale, wirtschaftliche und politische Verhältnisse zu untergraben. Wir müssen uns fragen: Wie kommen wir in eine vernünftige Balance? Eine starke Vermögensungleichheit hat zum Beispiel eine geringe Kaufkraft der Masse, eine höhere Instabilität am Finanzmarkt und einen schlechteren Gesundheitszustand der Bevölkerung zur Folge. Wir haben also eine Reihe nachteiliger Effekte, auch für die Chancengleichheit. Die Gesellschaft verkrustet mit der Zeit. Es gibt also auch ganz praktische Gründe, warum es Sinn macht, über die Vermögensverteilung nachzudenken.
Auch was die Machtasymmetrien und die Gestaltungsmöglichkeiten in einer Gesellschaft betrifft, ist die Frage großer Vermögen wichtig. Mit Vermögen ist immer auch ein großer Handlungsspielraum verbunden: Kann ich ein Unternehmen gründen, habe ich Einfluss auf Medien und politische Entscheidungen? Da wird das Vermögen zu einer demokratiepolitischen Frage.
Diese Diskussion gibt es seit 250 Jahren, seit der Aufklärungsphilosoph Rousseau im Sozialvertrag gesagt hat: Keiner sollte so reich sein, dass er sich den anderen kaufen kann.
Es geht also um die Frage, wieweit die ökonomischen Machtasymmetrien reichen dürfen, ohne dass sie den sozialen Frieden und die demokratische Gesellschaft gefährden oder praktisch in Frage stellen.
Die Vorschläge bei den Vermögenssteuern reichen von wenigen Prozent ab einer Million bis hin zu Abgaben von bis zu 60 Prozent ab einer Milliarde. Was wäre ein vernünftiges Modell?
Kapeller: Die unterschiedlichen Modelle verfolgen oft unterschiedliche Ziele. Wir haben vier grundsätzlich unterschiedliche Modelle untersucht. Eines davon würde zwar eine Vermögensbesteuerung einführen, aber an den Verteilungsverhältnissen nichts ändern, weil der Steuersatz zu gering ist. Da ist das Modell mit einem Steuersatz von pauschal einem Prozent ab einer Million Euro.
Dann gibt es zwei weitere Modelle, die vor allem die Vermögenskonzentration abdämpfen oder bremsen wollen. Die Eigendynamik ist ja, dass Reiche immer reicher werden und ärmere Haushalte eher stagnieren – und dadurch werden die Unterschiede im Zeitverlauf größer. Wenn man dem mit einer Steuer entgegen wirken will, müssen die Steuersätze progressiv sein. Ab 100 Mio. Euro und einer Milliarde Euro kommen dann höhere Steuersätze zum Einsatz.
Und dann gibt es schließlich ein Modell, das auf der Idee eines Maximalvermögens beruht und dies über eine progressive Vermögensbesteuerung zu implementieren versucht. Da wird dann ein Vermögen definiert, das man maximal sinnvoller Weise haben kann. Das liegt in dem von uns betrachteten Modell zwischen dem hundertfachen und dem tausendfachen des Durchschnittsvermögens, das ist also immer noch eine ganze Menge Geld, aktuell etwa bis zu 280 Mio. Euro, also keine niedrige Grenze. Alles, was darüber liegt, wird mit wirklich sehr hohen Steuersätzen von über 60% besteuert. Diese Idee geht auf Thomas Piketty zurück, einen besonders renommierten Verteilungsforscher, der das in seinem jüngsten Buch „Kapital und Ideologie“ genau so vorgeschlagen hat.
Grundsätzlich ist diese Idee des Maximalvermögens aber auch viel früher in der europäischen Geistesgeschichte zu finden. So existiert bereits bei Aristoteles und Platon die Vorstellung, dass von allen ökonomischen Ständen der Mittelstand am besten ist. Weil der ist nicht im Extrem, nicht in der Verschwendungssucht der Reichen, aber auch nicht im Jammertal der Armut. Der Mittelstand genügt daher am ehesten der Vernunft.
Die griechischen Philosophen argumentieren daher, dass jeder freie Bürger ein minimales Einkommen braucht, es gibt also eine Untergrenze. Und dann gibt es auch eine Obergrenze, über der für Platon etwas Unnatürliches liegt, etwas, das die Gesellschaft auch sprengt.
Bei Platon war die Obergrenze das 4-fache der Untergrenze. Insofern ist Pickety, wenn er sagt, das 100-fache vom Durchschnitt, im Vergleich zu Platon sehr großzügig.
Braucht es Vermögenssteuern zur Deckung der Kosten für die Corona-Krise?
Kapeller: Ungeachtet der Vermögensfrage ist meine Sicht, dass man die Corona-Krisenpolitik mit einer Klimapolitik koppeln muss, sonst kommt man mit der Dualität der größten Krisen unserer Zeit nicht zu Rande. Wenn wir in Europa schnell aus dem CO2 raus wollen, dann werden wir einen radikalen Strukturwandel in vielen Sektoren brauchen. Und ich sehe nicht, wie der angeschoben wird, wenn nicht die öffentliche Hand einsteigt. Natürlich wäre hier eine groß angelegte europäische Vermögenssteuer eine Möglichkeit, um die Mittel aufzubringen, die man braucht, um den Infrastrukturwandel zu finanzieren.
Die verfügbaren Technologien wären ja in vielen Punkten da: Wir können einen Zug bauen, der von Wien nach Berlin in fünf Stunden fährt, aber der jetzige braucht trotzdem neuneinhalb Stunden.
Aus meiner Sicht verfügen wir zwar über die nötigen Technologien, aber Europas Staaten wollen und können derzeit das Kapital nicht aufbringen, das für einen solchen klimaneutralen Umbau nötig wäre.