Hier können Sie die AI-generierte Audioversion dieses Artikels anhören.
Vered Berman ist in Westjerusalem aufgewachsen, lebt seit 22 Jahren in Berlin und engagiert sich seit ihrer Jugend für Frieden. 2003 hat sie ihre Mutter bei einem Selbstmordattentat der Hamas verloren. 20 Jahre später hat sie der Familie des Attentäters einen Brief geschrieben. Was sie dazu bewogen hat und warum der Dialog zwischen Israelis und Palästinenser:innen so wichtig ist, erzählt sie im Gespräch mit Kontrast. Obwohl sich die Situation für Friedensaktivismus in den letzten Jahren deutlich verschlechtert hat, ist sie überzeugt, dass es in Israel und Palästina zu einer friedlichen Lösung kommen wird. Denn das war historisch immer so, sagt sie. „Jeder Krieg endet irgendwann. Und zwar weil Politiker:innen mit Blut an ihren Händen dann aber doch – warum auch immer, aus welchem Druck auch immer – irgendein Abkommen unterschreiben.“ Dafür setzt sie sich gemeinsam mit palästinensischen und israelischen Hinterbliebenen im Verein Parents Circle – Families Forum ein.
Kontrast: Sie engagieren sich seit 2023 im israelisch-palästinensischen Friedens-Verein Parents Circle – Families Forum (PCFF). Was ist das Ziel dieser Organisation?
Vered Berman: In diesem Verein sind ausschließlich Menschen aus Israel und Palästina Mitglied, die jemanden in diesem Konflikt verloren haben. Bei mir ist es meine Mama, die 2003 bei einem Selbstmordattentat der Hamas ums Leben kam. Alle Mitglieder des Vereins haben diese schreckliche Eintrittskarte, so nennen wir das liebevoll.
Diese Organisation gibt es inzwischen bereits seit 30 Jahren. Im Jahr 1994 ist ein junger Soldat, Arik Frankental, 19 Jahre alt, nach Hause getrampt und wurde von den Leuten der Hamas entführt und ermordet. Sein Vater hat sich dann mit anderen israelischen Eltern zusammengetan. Daher kommt auch der Name Parents Circle (Eltern-Kreis, Anm.), weil es früher tatsächlich nur Eltern waren.
1998 gab es den ersten Kontakt mit Eltern in Gaza, die ihre Kinder auch im Konflikt verloren haben.
Es ging erstmal um Dialog, ums Kennenlernen, ums Verstehen, dass menschliche Trauer, menschlicher Schmerz einerseits nicht vergleichbar, anderseits doch immer gleich ist. Aber es ging sehr bald auch darum, politisch etwas zu bewirken, also die Besatzung abzubauen und auf Frieden hinzuarbeiten.
Das umfasst Gaza, die Westbank, Ostjerusalem und die palästinensische Bevölkerung in Israel: Jede Diskriminierung muss abgebaut werden. Es müssen alle Menschen frei und sicher leben dürfen. Ohne palästinensische Freiheit kann es keine israelische Sicherheit geben. Ohne israelische Sicherheit keine palästinensische Freiheit. Das geht Hand in Hand. Damit will ich keinesfalls Gewalt rechtfertigen. Darum geht es nicht, sondern darum, der Realität in die Augen zu blicken.
Wie dieser Frieden aussehen soll, gibt die Organisation nicht vor. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, es muss eine Zweistaatenlösung, eine Einstaatenlösung oder ein föderaler Staat sein. Uns geht es darum, dass das Blutvergießen aufhört. Dass wir zusammen an einen Tisch kommen und dass wir für Gerechtigkeit und Frieden, für all die Menschen eintreten, die zwischen dem Jordanfluss und dem Mittelmeer leben. Wie das am Ende aussieht, ist nicht unsere Hauptaufgabe.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Kontrast: Was ist die Hauptaufgabe?
Vered Berman: Wir haben zwei Hauptaktivitäten. Erstens unsere Dialogtreffen in israelischen Schulen. Zwei Mitglieder – ein:e Palästinenser:in und ein:e Israeli – sprechen dort mit Schüler:innen der Oberstufe. Das sind Kinder, die demnächst Soldaten werden. Viele kennen nur ein sehr entmenschlichendes Narrativ über „die andere Seite“. Wenn man mit einer persönlichen Trauergeschichte kommt und erzählt, warum man das macht und für Frieden arbeitet, bewirkt das etwas bei den Jugendlichen – dass sie diese Menschen aus Palästina, die vor ihnen sitzen, als Menschen sehen können.
Das lief ziemlich erfolgreich viele Jahre – bis 2023. Denn da hat Yoav Kisch, der israelische Bildungsminister, diese Veranstaltungen verboten. Dagegen haben wir zwar erfolgreich geklagt, aber kurz darauf wurden die Gesetze so geändert, dass wir erneut klagen müssen – und uns seitdem ständig in Klagen befinden.
Zweitens machen wir Gedenkveranstaltungen gemeinsam mit Combatants for Peace. Das ist eine Friedensorganisation von ehemaligen Kämpfer:innen aus Israel und Palästina, die ihre Waffen niedergelegt haben. Seit 20 Jahren machen wir gemeinsam eine Zeremonie am israelischen Nationalen Gedenktag für gefallene Soldaten und Terroropfer. Nur dass wir allen Opfern gedenken, weil es die nicht nur auf unserer Seite gibt. 2023 waren 18.000 Menschen anwesend. Seitdem ist es allerdings sehr gefährlich geworden, für Frieden zu sprechen. Die Repression und Gewalt von rechtsradikalen Menschen in Israel und von der Polizei sind sehr massiv geworden. In den vergangenen zwei Jahren wurde deshalb die Gedenkfeier an einem geheimen Ort abgehalten und nur ausgestrahlt. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen wurde dieses Jahr einer der Ausstrahlungsorte – eine Reformsynagoge in Ra’anana – attackiert und drei Menschen krankenhausreif geschlagen.
Kontrast: Wie argumentiert die israelische Seite das Verbot der Schulaktionen?
Vered Berman: Der Hauptvorwurf ist, dass wir Terroropfer mit Terroristen gleichsetzen würden. Weil – und das sagen wir auch ohne Scham – alle bei uns mitmachen dürfen, die jemanden verloren haben und an Frieden und Dialog glauben. Ich kenne jetzt kein Familienmitglied von Täter:innen, aber es ist nicht ausgeschlossen. Wenn ein Geschwisterteil von dem Mann, der meine Mama ermordet hat, sagen würde, ich habe meinen Bruder verloren und glaube an Frieden, dann darf er mitmachen.
Denn Frieden macht man nicht mit dem besten Freund. Frieden macht man mit sogenannten Feinden und deshalb ist es auch wichtig, dass wir diesen Grundsatz haben. Deshalb habe ich auch der Familie des Attentäters einen Brief geschrieben.
Kontrast: Darf ich fragen, was Sie der Familie geschrieben haben?
Vered Berman: Ich war 19 Jahre alt und gerade als Au-pair Mädchen in Berlin, als ich diesen Anruf bekommen habe, dass meine Mama tot ist. Sie war gerade 50 Jahre alt geworden und kerngesund. Sie wurde bei einem Selbstmordattentat 2003 ermordet – das war während der Zweiten Intifada. Ich musste jahrelang dieses Trauma verarbeiten und habe mich in der Zeit nie mit dem Attentäter beschäftigt. Erst 20 Jahre später, nach dem 7. Oktober 2023, der mich sehr stark retraumatisiert hat, habe ich angefangen, mich mit seiner Geschichte zu beschäftigen, mit seiner Familie und vor allem mit seiner Menschlichkeit. Ich habe alle Artikel darüber gelesen, die ich finden konnte.
Was muss er geglaubt haben, um sich eines Morgens von seiner Mutter zu verabschieden, nach Jerusalem zu fahren und 17 Leute umzubringen?
Ich lebe ja seit 20 Jahren in Deutschland, also im Täterland. Meine Großeltern sind selbst jeweils die einzigen Überlebenden aus deren Familien und meine Familie, die ich hier gegründet habe, ist zur Hälfte deutsch (nicht jüdisch). Meine Partnerin kommt aus einer Mitläuferfamilie. Menschlichkeit bekommt dann eine neue Bedeutung. Es ist alles nicht so schwarz-weiß.
Im Brief an seine Mutter habe ich im Kern genau von dieser Menschlichkeit geschrieben, von meiner Hoffnung und meinen Erfahrungen bei PCFF. Dass ich Palästinenser:innen kennengelernt habe, die auch ihre Kinder oder Eltern verloren haben und dass einfach ganz klar ist, dass wir alle Menschen sind. Die Soldaten, die jetzt in Gaza Kriegsverbrechen begehen, sind Menschen und die Terroristen, die am 7. Oktober Kriegsverbrechen begangen haben, sind auch Menschen. Das sind alles Menschen mit Hoffnungen, mit Liebe, die glauben müssen, dass die andere Seite nicht menschlich ist, weil ansonsten kann ich mir nicht erklären, wieso Menschen so etwas machen können. Ich habe geschrieben, dass ich hoffe, dass meine Enkelkinder seine Großnichten und -neffen – weil Kinder hatte er keine -, auch so lieben können, wie ich meine Partnerin liebe.
Der Brief schließt mit “I am sorry for your loss.” („Es tut mir Leid für Ihren Verlust.“, Anm.)
Im März habe ich erfahren, dass die Mutter erst ein paar Monate zuvor verstorben ist – noch bevor der Brief ankam. Das hat mich seltsamerweise getroffen. Das hätte ich nicht gedacht. Ist das Trauer? Und wenn ja, warum trauere ich um diesen Menschen, der den Mörder meiner Mama erzogen hat? Ich glaube, es war Trauer wegen einer verpassten Gelegenheit. Ich habe inzwischen die Telefonnummer vom Bruder des Attentäters bekommen. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe, aber ich möchte unbedingt, dass dieser Brief ankommt. Obwohl ich natürlich nicht weiß, was ich erwarten kann, ob er auch Interesse an Dialog hat.
Kontrast: Wie haben Sie die Begegnungen mit Palästinenser:innen, die Angehörige verloren haben, bisher erlebt?
Vered Berman: Es ist vor allem schmerzhaft. Ich meine, alle Geschichten sind tragisch und furchtbar. In einem meiner ersten PCFF-Treffen hat Laila Alsheikh erzählt, wie ihr 6 Monate alter Sohn aufgrund von Krawallen auf der Straße zu Hause Tränengas eingeatmet hat. Dann wurden sie so viele Stunden an den Checkpoints aufgehalten und davon abgehalten, ins Krankenhaus zu kommen, dass er daran gestorben ist. Er hätte gerettet werden können. Es ist alles so sinnlos. Es ist alles so vermeidbar. Das ist der Grund, warum ich das mache. Es ist keine naive Hoffnung, irgendwann kommt dieser Frieden, wenn wir nur Kumbaya singen. Es ist ein Wissen, das man hat, wenn man in die Geschichte zurückschaut. Jedes gewaltvolle Regime fällt irgendwann.
Jeder Krieg endet irgendwann. Und zwar weil Politiker:innen mit Blut an ihren Händen dann aber doch – warum auch immer, aus welchem Druck auch immer – irgendein Abkommen unterschreiben. Und dann hören auf einmal die Soldaten auf, sich gegenseitig umzubringen oder Kinder umzubringen. Ich weiß, dass der Tag kommen wird. Bis dahin ist jeder Tod einfach absolut sinnlos. Israel ist kein bisschen sicherer dadurch, dass dieses Baby oder meine Mutter gestorben ist – und Palästina ist kein bisschen freier.
Ich hoffe, dass wenn wir laut genug mit unserer Botschaft sind, dass dieser sinnlose Schmerz früher aufhört und dass andere Menschen das nicht durchmachen müssen.
Seit 2024 gibt es dafür einen Unterstützungsverein in Deutschland, den Parents Circle Friends Deutschland e. V.
Kontrast: Sie haben 2024 den deutschen Verein Parents Circle Friends Deutschland (PCFF-Deutschland) mitgegründet. Was wollen Sie damit erreichen?
Vered Berman: Wir wollen die Botschaft von Frieden, Dialog und Gerechtigkeit verbreiten sowie PCFF in Israel/Palästina mit Fundraising unterstützen. Wir veranstalten in Deutschland auch gemeinsame Gedenktage und Events, wo wir Mitglieder aus Israel und Palästina einladen.
Wir wollen uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam für eine bessere Zukunft kämpfen. Noch ist alles ehrenamtlich, aber wir wollen wachsen. Wir wollen vor allem Frieden in Israel und Palästina unterstützen und fördern, aber auch den Dialog hier. Denn der Diskurs hier ist so verhärtet. Wir hatten eine Gruppe Young Ambassadors for Peace in Berlin, die gezeigt haben, dass es selbstverständlich ist, dass Palästinenser:innen und Israelis für den Frieden zusammenarbeiten. Dort erzählen dann junge, starke Leute, wie etwa eine 19-Jährige, die ihren Bruder verloren hat, so selbstbewusst von Frieden, Gerechtigkeit und natürlich auch von Freiheit.
Ich habe manchmal das Gefühl, sie sitzen hier vor einem deutschen Publikum, das sie therapieren müssen, also uns zeigen müssen, wie man miteinander ins Gespräch kommt.
Denn hier kommt von der pro-palästinensischen Seite häufig der Vorwurf der Normalisierung. Jede Arbeit mit Israelis – auch mit kritischen Israelis – würde die Besatzung normalisieren und deshalb darf man mit Israelis überhaupt nicht arbeiten. Das finde ich sehr frustrierend.

Kontrast: Auch in Österreich ist die Debatte sehr aufgeheizt – was würden Sie Personen raten, die über dieses Thema reden?
Vered Berman: Mein Rat ist immer, die Leute in Palästina, in Israel vor Ort zu unterstützen, die gemeinsam arbeiten. Davon gibt es über PCFF hinaus sehr viele. Zum Beispiel Standing Together, Women of the Sun und Women Wage Peace oder Combatants for peace. Die Alliance for Middle Eastern Peace, die politische Arbeit für Friedensorganisationen machen, vernetzt 170 Organisationen in Israel und Palästina, die für Frieden arbeiten – und damit natürlich gegen die Besatzung.
Wenn sich dann der Feed auf TikTok oder Instagram mit den Inhalten dieser Organisationen füllt, hat man dieses duale Narrativ, also beide Seiten. Wobei ich ja finde, dass der Diskurs vor Ort oft gar nicht Israel gegen Palästina ist, sondern eher Menschen für Frieden bzw. gegen die Besatzung und Menschen gegen Frieden. Das sind eher die verhärteten Seiten.
Kontrast: Aber welche Menschen können überhaupt Krieg wollen?
Vered Berman: Dreckige, machthungrige Politiker:innen. Es ist natürlich komplexer, aber bis Mitte der 90er Jahre war Frieden noch eine Sache, von der man träumen durfte. Damals hat Jitzchak Rabin (damaliger israelischer Ministerpräsident, Anm.) mit Jassir Arafat (ehemaliger Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Anm.) einen Friedensprozess angefangen – der auch kritisiert werden kann – aber es war auf jeden Fall ein Versuch. Danach gab es noch ein paar Versuche, die aus unterschiedlichen Gründen gescheitert sind.
Seit Jahrzehnten hat Israel rechte Regierungen, wobei es noch nie so krass rechts war wie jetzt. In der jetzigen Regierung sind zum Teil messianische Zionisten, die an eine jüdische Großmacht glauben. Das sind sehr gefährliche Menschen, die auf eine rassistische Art glauben, dass es bessere und schlechtere Menschen gibt.
Es ist in den letzten 30 Jahre viel gemacht worden, um jedes Gespräch über Frieden zu zerstören, Frieden zu einem Schimpfwort zu machen und die andere Seite zu entmenschlichen. Das passiert auf beiden Seiten.
Es gab z.B. Anfang der 2000er ein Projekt, bei dem die Sesamstraße zweisprachig auf arabisch und hebräisch gezeigt wurde. Nach zwei, drei Jahren hat es der israelische Bildungsminister verboten, weil man “die Lügen der Koexistenz den Kindern nicht verkaufen” dürfe. Es gibt auch ein sehr schönes Geschichtsbuch von Dan Bar-On und Sami Adwan, das auf Deutsch “Die Geschichte des anderen kennenlernen” heißt. Sie haben mit Lehrer:innen die Geschichte von Israel und Palästina ab der Balfour-Deklaration (als sich Großbritannien 1917 einverstanden erklärte, in Palästina eine „nationale Heimstätte“ zu errichten, Anm.) bis in die 90er Jahre beschrieben.
Es ist ein Buch für Schüler:innen in Israel und in Palästina, wo auf jeder Seite die israelische und die palästinensische Sichtweise abgebildet ist. 2008 wurde es auf beiden Seiten verboten.
Es wird ganz aktiv gegen Frieden und gegen ein Bild von Menschlichkeit gearbeitet. Denn wenn man die andere Seite liest, dann versteht man das Narrativ: Dass man nach jahrtausendelangen Verfolgungen bis hin zum Holocaust einfach nur Sicherheit und ein neues Land will. Und man versteht ein Narrativ von einem Volk, das von einem Kolonialismus zum nächsten springt und seit 75 Jahren unterdrückt wird. In dem Moment, wo man es versteht, will man es nicht so haben. Und das ist natürlich gefährlich für eine Regierung, die an der Macht bleiben will.
Politikwissenschaftler Thomas Schmidinger zu Gaza-Krieg: „Druck aus Europa könnte etwas bewirken“

































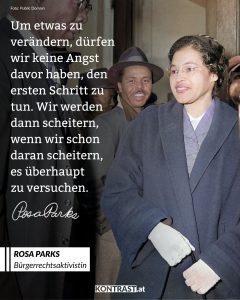

Selbstverständlich hat Israel das Recht sich im Rahmen der Hager Landkriegsordnung, dem Völkerrecht und den intentionalen Abkommen, sich zu verteidigen.
–
Das recht der Selbstverteidigung inkludiert allerdings nicht, Internationale Normen, Abkommen und Konventionen zu missachten und zu verletzten.
–
Das gilt für jeden Staat der Welt, für Israel ebenso wie für die USA, Russland, Ukraine. Wer das Völkerrecht missachtet, der Begeht ein Verbrechen.
–
Ich bewerte und verurteile die Situation nicht, es ist Aufgabe der intentionalen Staatengemeinschaft dafür zu sorgen das das Völkerrecht respektiert wird, und es ist Aufgabe des Internationalen Strafgerichtshof Verletzungen strafrechtlich zu verfolgen und gegebenenfalls zur Anklage zu bringen und zu Verurteilen.
–
Eine Verurteilung hat für Staaten und Einzelpersonen schwerwiegendste Konsequenzen, wenn man sich dessen Schuldig macht was die schwersten Verbrechen die der Mensch begehen kann schuldig machte.
–
Im Konkreten Fall ist es somit im ureigensten Interesse Israels selbst, dafür zu sorgen das intentionales Recht eingehalten wird.
–
Persönliche Anmerkung, es ist irgendwie wie bei der Polizei, der sind die Hände durch die Rechtsstaatlichkeit gebunden, müssen sich an Gesetzte halten, während der Verbrecher sich an keine Normen und Regeln hält. Die Polizei kann sich allerdings einen Fehler nach dem anderen Erlauben bis der Täter gefasst ist, während der Täter selbst sich keine Fehler erlauben darf, der kleinste Fehler und man ist gefasst. Damit besteht trotz Ungleichheit wieder Gleichheit.
Liebe Lena, dein großartiger Beitrag über Vered Berman und PCFF ist ermutigend und gibt Anlass, zu hoffen, dass letztlich Vernunft und Menschlichkeit siegen werden. Ich hab ihn gerade gepostet.