Im Jahr 2040 soll eine Zugfahrt von Wien nach Berlin so lange dauern wie ein längerer Filmabend: viereinhalb Stunden. Heute braucht der Zug über acht Stunden. Die EU will, dass diese Schnellzüge zur Normalität werden – und Europas Städte sich näher anfühlen als je zuvor. Dafür plant sie ein dichtes Netz von Hochgeschwindigkeitszügen, das die großen Städte unseres Kontinents verbindet.
Die Karte der künftigen Schnellzüge liest sich wie eine Einladung zum Städtehüpfen. Berlin–Kopenhagen in vier Stunden, Madrid–Lissabon in drei statt neun, Berlin–Prag–Wien in viereinhalb statt mehr als acht Stunden. Zwischen Sofia und Athen oder Budapest und Bukarest soll sich die Reisezeit ebenfalls fast halbieren. Auch der Norden rückt zusammen: Mit Rail Baltica werden Tallinn, Riga und Vilnius erstmals direkt an das westeuropäische Netz angeschlossen.
Mit 200 km/h sind Schnellzüge auf bewährten und neuen Gleisen unterwegs
Damit das möglich wird, reichen ein paar neue Fahrpläne nicht aus. Die EU will alte Strecken ausbauen, neue Tunnel und Brücken bauen und Lücken an den Grenzen schließen. Kern des Plans ist das TEN-V-Netz, eine Art Rückgrat für den Verkehr in Europa.
Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland verfügen aktuell über den größten Teil der bestehenden 12.000 Kilometer Schnellzugnetze. Sie sollen als Vorbilder für die Länder Mittel- und Osteuropas dienen, wo moderne Strecken weitgehend fehlen.

Auf vielen Abschnitten sollen Züge mindestens 200 Kilometer pro Stunde fahren, auf einigen deutlich darüber. Ein digitales Zugleitsystem mit einheitlichen Standards (ERTMS) soll den Verkehr dichter und sicherer machen.
Nicht nur für Urlaubende erfreulich: Hochgeschwindigkeitszüge verringern am Ende auch LKW-Staus auf den Straßen
„Die Menschen wollen auf nachhaltige Transportmöglichkeiten umsteigen. Wir müssen ihnen leistbare und attraktive Alternativen dafür bieten. Der von der Kommission vorgelegte Plan für ein europäisches Hochgeschwindigkeitsnetz ist genau das, was Europa jetzt braucht“, fasst SPÖ-EU-Delegationsleiter und Mitglied im Verkehrsausschuss Andreas Schieder zusammen.
Von dem Netz profitieren aber nicht nur Geschäftsleute und Touristinnen. Wenn mehr Menschen schnelle ICE/Railjet-ähnliche Züge nutzen, werden andere Strecken frei. Dort können wiederum Nachtzüge und Güterzüge leichter Platz finden. Für Speditionen kann das bedeuten: weniger Lastwagen-Staus auf den Straßen, mehr verlässliche Transporte auf der Schiene.
Dafür ist man auch bereit, kräftig zu investieren. Die EU schätzt, dass bis 2040 rund 345 Milliarden Euro nötig sind, um das geplante Kernnetz fertigzustellen. Wenn in großem Stil Strecken für mehr als 250 Kilometer pro Stunde ausgelegt werden, könnte die Summe bis 2050 auf etwa 546 Milliarden Euro steigen.
Bezahlen sollen EU-Fördertöpfe wie „Connecting Europe Facility“, Kredite der Europäischen Investitionsbank und private Anleger – gebündelt in einem „High-Speed-Rail-Deal“, den Brüssel 2026 schmieden will. Um private Investoren anzulocken, müsse der Betrieb der neuen Strecken wirtschaftlich sein, heißt es aus der Kommission.
Die EU-Eisenbahnagentur ERA soll starke Befugnisse erhalten und für einheitliche technische Standards in dem geplanten Netz sorgen.
Der Klimaschutz Europas auf Schienen
Hinter dem Plan steht nicht nur der Wunsch nach Bequemlichkeit. Hochgeschwindigkeitszüge sind Teil der Klimapolitik: Jede Reise, die vom Kurzstreckenflug auf die Schiene wechselt, spart CO₂. Die Kommission will den Hochgeschwindigkeitsverkehr bis 2030 im Vergleich zu 2015 verdoppeln und bis 2050 verdreifachen.
Gelingt das, könnten Europas Städtereisen eines Tages ganz selbstverständlich mit dem Zug stattfinden.




























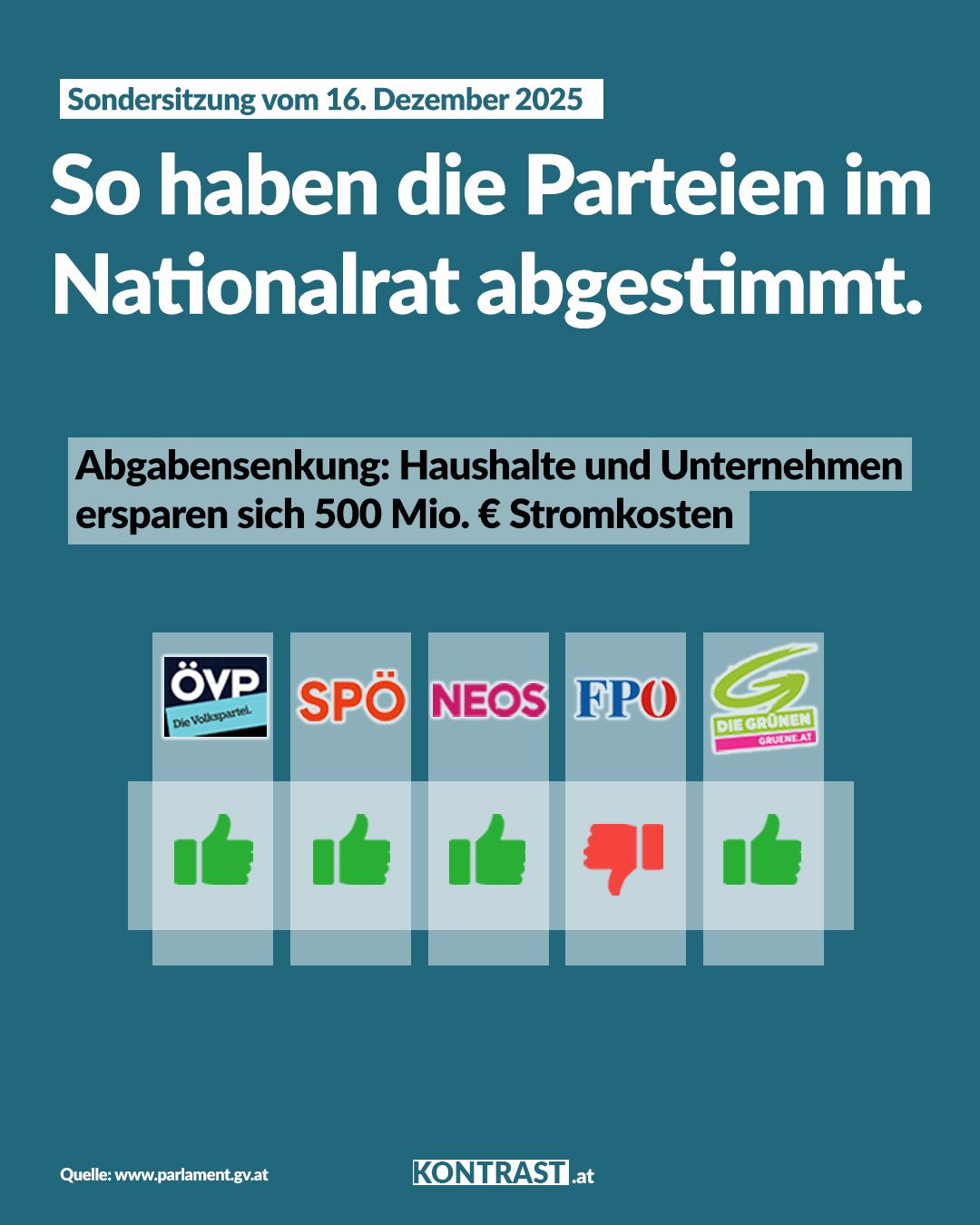


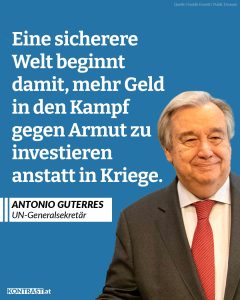




was sofort bei der Verbindungskarte auffällt ist, dass Deutschland weiter ein weißer Fleck der schnellen Zugsverbindungen bleibt und außer Berlin auch keine Knoten beinhaltet. Ist sehr bedenklich was die Zukunft Deutschlands betrifft.
Abgesehen davon wäre es endlich notwendig die Subvention von Flugverkehr einzustellen (Kerosinsteuer, Grundverkehrssteuer, …..)
Faire Vollkosten-Preise für Kurzstreckenflüge und LKW-Transporte.
Keine Förderungen und Steuererleichterungen für die Generierung von CO2! –
Kostendeckende CO2-Abgaben für die Vorbeugung und Kompensation von Klimaschäden auf der ganzen Welt!