Die Ackerflächen in Österreich sind bedroht. Immer mehr Flächen, die früher landwirtschaftlich genutzt wurden, verschwinden. Entweder werden sie zu Bauland umgewidmet und zubetoniert oder sie verwalden. Wenn es aber weniger Felder gibt, können wir in Österreich weniger anbauen. Das verstärkt unsere Abhängigkeit von Lebensmittel-Importen aus dem Ausland. Die verbliebenen Felder werden außerdem immer teurer, sodass kleine Bauernhöfe zugunsten von Großbetrieben unter die Räder kommen.
Laut einer Infobroschüre des Bundesministeriums für Landwirtschaft sind Ackerflächen in Österreich seit den 1960er Jahren um 18 Prozent zurückgegangen. Dabei sind diese Flächen wichtig, um die Versorgungssicherheit der österreichischen Bevölkerung sicherzustellen. Wenn weniger Lebensmittel im Inland produziert werden, müssen wir mehr aus dem Ausland importieren. Internationale Krisen könnten Österreich dann härter treffen. Mehrere Entwicklungen bedrohen Österreichs Ackerflächen.
Verwaldung: Immer mehr Grünland und Almen verschwinden
Ein Grund für das Verschwinden der Ackerflächen ist, dass immer mehr Felder verwalden. Etwa die Hälfte der Landesfläche Österreichs ist mit Wald bedeckt. Demgegenüber wird etwas mehr als ein Drittel der Landesfläche landwirtschaftlich genutzt. In den 1960er Jahren war dieses Verhältnis noch umgekehrt: Damals dienten 38% der Landesfläche der Forstwirtschaft und 49% der Landwirtschaft. Heute gibt es also mehr Wälder, dafür weniger Ackerflächen. Hierzulande trifft das hauptsächlich auf Grünland in alpinen Regionen zu. Diese Landschaft hat nicht nur eine wichtige Bedeutung für den Tourismus, sondern spielt auch eine Rolle für das Ökosystem.
Bodenversiegelung: Täglich werden 16 Fußballfeldgroße Felder verbaut
Darüber hinaus schreitet die Bodenversiegelung voran. Der grundsätzlich fruchtbare Boden wird der Landwirtschaft Stück für Stück abgerungen. Flächen in den Randgebieten von Siedlungen werden umgewidmet und dienen dem Ausbau der “Speckgürtel”-Regionen: Einfamilienhäuser mit Gärten werden fernab vom Ortskern aus dem Boden gestampft. Dazu kommt der notwendige Ausbau von Straßen und die Errichtung von Nahversorgern. Von 2019 bis 2021 wurden pro Tag im Schnitt 11,3 Hektar verbaut, das entspricht etwa der Fläche von 16 Fußballfeldern.
Diese Flächen sind für die Erzeugung von Lebens- oder Futtermitteln sowie Saatgutproduktion verloren. Zudem sind häufig sogenannte landwirtschaftliche Gunstlagen von der Versiegelung betroffen – also besonders fruchtbare Flächen. Dabei liegt die Mehrheit der Betriebe (78 %) ohnehin in benachteiligtem Gebiet. Das bedeutet, sie haben durch Steilhanglagen oder ähnliche Erschwernisse gegenüber den Gunstlagen einen ökonomischen Nachteil.
Im Jahr 2022 waren gemäß Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft bereits insgesamt 5.648 km² verbraucht. Das entspricht 6,7 % der Landesfläche mit 83.884 km² und 17,3 % des Dauersiedlungsraums.
Österreich ist mittlerweile Hochpreisland für Grund & Boden
Die Versiegelung von landwirtschaftlich genutzten Flächen hat noch einen weiteren Nebeneffekt: Indem Ackerland in Bauland umgewidmet wird, steigert sich der Wert eines Grundstücks quasi über Nacht enorm. Wenn der Grund noch vor einer Umwidmung gekauft wird, kann damit ein kleines Vermögen erzielt werden. Daher sind Äcker in der Nähe von Ballungsräumen besonders begehrt.
Ein solches Szenario hat sich zum Beispiel in der Umgebung der Seestadt Aspern in Wien zugetragen. Der Standard berichtete 2023, wie eine landwirtschaftlich genutzte Fläche von 150.000 Quadratmetern an 10 verschiedene Bauträger zu je 300 Euro pro Quadratmeter verkauft wurde. Gesamtsumme des Kaufvertrages: 45 Mio Euro. – ein rein spekulatives Geschäft, denn für gewöhnlich liegt der Quadratmeterpreis für Ackerflächen im niedrigen zweistelligen Bereich.
In der Theorie sollten solche Vorkommnisse durch die Grundverkehrskommission verhindert werden. Denn Im Gesetz ist festgehalten, dass Landwirt:innen, die Interesse am Erwerb einer landwirtschaftlich genutzten Fläche haben, Vortritt zu geben ist (gegenüber Parteien, die den Grund nicht landwirtschaftlich nutzen werden). In der Praxis kommt es seit Jahrzehnten trotz dieser klaren Gesetzeslage immer wieder zu Verstößen, etwa im Fall eines Grundstückskaufs im salzburgischen Pinzgau. Hier wurden bereits 1994 Agrarflächen in Bauland umgewidmet, um Zweitwohnsitze beim Pass Thurn zu errichten.
Dass es sich bei diesen Beispielen jeweils um branchenfremde Käufer handelte, ist kein Einzelfall. Zahnärzt:innen, Richter:innen, Akademiker:innen aller Art, juristische Personen, Industrielle wie Bauträger:innen betrachten den Besitz von Flächen als Investmentanlage. Wozu das führt, ist offensichtlich: wenig verfügbare Fläche und hohe Nachfrage haben Österreich inzwischen zu einem Hochpreisland für Grundstücke gemacht. Ein Trend, der sich laut Profil bereits seit dem Ausbruch der Finanzkrise abgezeichnet hat. Diese Entwicklung fällt wiederum zu Lasten von Bäuer:innen. Sie können sich den Erwerb neuer Gründe aufgrund der Wucherpreise nicht leisten.
Große Massenbetriebe verdrängen kleine Bauernhöfe
Mit Stand 2023 gab es in Österreich rund 150.000 land- und forstwirtschaftliche Betriebe. 1951 lag die Zahl noch bei 433.000 Betrieben. Das ist ein Rückgang von 64%. Auch die Zahl der Arbeitskräfte nimmt kontinuierlich weiter ab. Waren 1951 noch über eineinhalb Millionen Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt, waren es 2020 nur noch 420.018.
Gleichzeitig werden die Betriebe immer größer, wie Daten der Statistik Austria zeigen. Seit den 1950er-Jahren hat sich die durchschnittliche Betriebsgröße mehr als verdoppelt. Alleine zwischen 2010 und 2020 hat sich die durchschnittlich landwirtschaftlich genutzte Fläche pro Betrieb von 18,8 ha auf 23,6 ha erhöht.
Dennoch gilt die Verteilung der Agrarflächen ähnlich wie beim Forstbesitz hierzulande noch immer als kleinstrukturiert. Das heißt, bei der Mehrheit (93%) handelt es sich um kleine Familienbetriebe. Die konnten zwar ihre Nettogewinne 2023 um 24 Prozent steigern, ihre Lage bleibt aber prekär. Profite machen vor allem die Großen.
Mit Fördergeldern verschärft man diese Ungleichheit: In Österreich gibt es eine Reihe von Zuschüssen, von denen letztendlich vor allem Großagrarier profitieren. Etwa einen 450 Millionen Euro schweren Waldfonds.
Dass vor allem Großagrarier mit Fördergeldern versorgt werden, ist auch deshalb brisant, weil die größten Privatwälder den reichsten Bürger:innen Österreichs gehören. Auch die EU-Förderungen kommen zum größten Teil Agrarkonzernen und nicht kleinen Bauernhöfen zugute.
Adel, Klöster, Bundesforste: Wer besitzt Österreichs Wälder?


































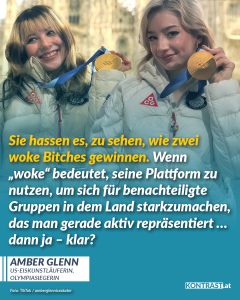

die Boden Versiegelung ist ja logisch umso mehr Einwohner umso mehr Wohnungen und Infrastruktur, aber das versteht man nur wenn man im Kopf nicht nur Stroh hat
432 Park Avenue zeigt das es auch ganz anders geht, auf 28 mal 28 Meter lassen sich pro Etage 8 Wohnungen zu 80 Quadratmeter realisieren. Bei einer Belegung von 1,5 ergibt das 1020 Einwohner.
–
Die etwas großzügigere Variante mit 4 Wohnungen zu jeweils 150 Quadratmeter sind es bei gleicher Belegung immer noch 510 Einwohner die darin Platz hätten.
–
Zur Relation 110 Gemeinden in Österreich haben weniger als 510 Einwohner, 421 Gemeinden kommen auf weniger als 1020 Einwohner.
–
Das ganze ist aus gutem Grund konservativ gerechnet, es braucht einen gewissen Luxus und somit Anreiz auf die Eigene Hütte zu verzichten, 150 Quadratmeter mit 4 Wohnungen pro Etage bitten den.
–
Man kann auch so deppert Bauen wie in Wien in der Seestadt und andere Stadtentwicklungsgebieten, dann darf man sich auch nicht wundern wenn ganz Österreich in wenigen Jahren zugepflastert ist.
–
Auch landwirtschaftlich lassen sich solche Bauten nutzen, in dem Fall würden sich in so einem Turm etwa 74.000.000 Tomaten mit einem Gewicht von 13.000 Tonnen züchten lassen.
–
Wir haben genügend Grund und Boden in Österreich, selbst für 20.000.000 Einwohner, wenn der intelligent genutzt wird.
du hast fast recht aber du vergisst immer mehr Bewohner haben immer mehr Bedürfnisse Größer Infrastruktur 100000 Bewohner mehr in 10 Jahren brauchen für dies zahl auch leben mittel usw lkw verkehr und mehr