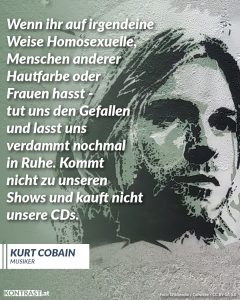Hier können Sie die AI-generierte Audioversion dieses Artikels anhören.
In Österreich erleidet etwa jede dritte Frau einen Verlust, der mit einer gewollten Schwangerschaft einhergeht, so die Schätzungen. Entweder passiert es während der Schwangerschaft, während der Geburt oder kurz danach – dass sie ein Leben betrauert, statt es willkommen heißen zu können. Trotz dieser hohen Zahl an Betroffenen bleibt das Thema in der öffentlichen Diskussion weitgehend tabu. Ob eine Mutter staatliche Unterstützung erhält, hängt derzeit schlicht vom Geburtsgewicht des verstorbenen Kindes ab – eine Regelung, die immer wieder Kritik hervorruft. Zahlreiche Stimmen fordern daher mehr Unterstützung für betroffene Mütter und Familien.
Nicht jede Schwangerschaft nimmt einen glücklichen Verlauf. In Österreich gibt es jährlich laut Schätzungen etwa 10.000 bis 12.000 sogenannte Sternenkinder – Babys, die vor, während oder kurz nach der Geburt versterben. Trotz der hohen Zahl an Schwangerschaftsverlusten bleibt das Thema in öffentlichen Debatten weitgehend unbeachtet – und viele betroffene Eltern sind mit ihrer Trauer allein. Gesellschaftlich wie rechtlich gibt es wenig Unterstützung.
Ein zentrales Problem: Sternenkinder werden rechtlich nicht einheitlich behandelt. Denn in Österreich entscheidet eine gesetzlich festgelegte Grenze von 500 Gramm Geburtsgewicht darüber, ob ein Kind als Totgeburt oder „Fehlgeburt“ gilt – und mit welchen Rechten und Unterstützungen die Mutter rechnen kann.
Das Hebammengesetz unterscheidet klar: Wird ein Kind ohne Lebenszeichen geboren und wiegt mindestens 500 Gramm, handelt es sich um eine Totgeburt. Liegt das Gewicht darunter, spricht das Gesetz von einer „Fehlgeburt“. Betroffene lehnen die Bezeichnungen Fehlgeburt ab, „da kein Kind fehlerhaft ist“. Die rechtlichen Unterschiede sind enorm: Nur bei Totgeburten besteht eine Meldepflicht, ein Anspruch auf Mutterschutz sowie Zugang zu Hebammenbetreuung und finanzielle Unterstützung – bei Fehlgeburten hingegen nicht.
500 Gramm entscheiden, ob Frauen unterstützt werden
Die gesetzlich festgelegte 500-Gramm-Grenze ist eine Vorgabe der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die als statistische Größe eine internationale Vergleichbarkeit schafft. Doch viele Frauen und Organisationen halten diese Grenze für willkürlich. Denn sie berücksichtigt nicht, was die Betroffenen durchmachen.
„Diese 500 Gramm-Grenze sagt nichts über die Geburt aus – es ist komplett egal, ob es 500 Gramm oder 2,3 Kilo sind. Diese Bestimmung sagt nichts über den Vorgang in einer Frau aus, was die Frauen dort durchmachen“ so Monika Romaniewicz vom Verein „Rechte für Sternenmamas“.
Monika Romaniewicz ist eine von vielen Frauen in Österreich, die eine stille Geburt hinter sich haben. Sie verlor ihr Kind in der 20. Schwangerschaftswoche. Ihr Baby wog weniger als 500 Gramm – und damit entfiel jeder gesetzliche Anspruch auf Nachbetreuung oder Mutterschutz. Nach einer 48-stündigen stillen Geburt wurde sie ohne psychologische Begleitung oder weitere Hilfe aus dem Krankenhaus entlassen. Man hat ihr lediglich einen Zettel mit Bestattungsinformationen in die Hand gedrückt. Schon zwei Wochen später kehrte sie an ihren Arbeitsplatz zurück: „Ich bin eigentlich noch im Wochenbett arbeiten gegangen“.
Aus ihrer Erfahrung heraus gründete Romaniewicz den Verein „Rechte für Sternenmamas“. Sie will auf das Thema aufmerksam machen und politische Veränderungen anstoßen. Denn sie ist nicht allein: Viele Frauen berichten von ähnlichen Erfahrungen.
Laut einer Lancet-Studie erleiden weltweit jedes Jahr rund 23 Millionen Frauen eine „Fehlgeburt“ – das entspricht etwa jeder siebten Schwangerschaft.
In Österreich ist offiziell von mindestens jeder zehnten Schwangerschaft die Rede, doch die tatsächliche Zahl liegt eher bei jeder dritten. Zuverlässige Daten gibt es nicht – denn besonders frühe Schwangerschaftsverluste – in den ersten zwölf Wochen – bleiben häufig unerfasst, da sie nicht meldepflichtig sind.
Wie Tabus das Trauern erschweren
Ein Schwangerschaftsverlust ist für viele Frauen und Paare eine tiefgreifende emotionale Belastung. Gefühle wie Trauer, Schuld, Scham, Wut oder Hilflosigkeit dominieren. Vor allem das Tabu rund um Fehl- und Totgeburten trägt dazu bei, dass Betroffene sich allein gelassen fühlen.
„Fehlgeburten“ gehören zu den häufigsten Ereignissen im Leben einer Frau. Gleichzeitig zählen sie aber auch zu den am seltensten besprochenen Ereignissen. Laut Romaniewicz liegt das einerseits daran, dass die Gesellschaft generell schlecht mit dem Thema Tod umgehen kann. Andererseits geht es hierbei um ein Frauen-Thema: „Das Thema Frauen ist natürlich sehr schwierig – man muss sich nur die patriarchalen Strukturen anschauen.”
Auch die häufig empfohlene „12-Wochen-Regel“, nach der Frauen ihre Schwangerschaft erst nach dem ersten Trimester öffentlich machen sollten, trägt zur Tabuisierung bei. Wer seine Schwangerschaft davor verliert, hat oft nicht einmal ein soziales Umfeld, das von der Schwangerschaft wusste – geschweige denn von der anschließenden Trauer.
Bestehende Lücken im Mutterschutz: Forderungen werden laut
Ein kleiner Fortschritt wurde bereits erzielt: Seit September 2024 besteht nun bei „Fehlgeburten“ nach der 18. Schwangerschaftswoche Anspruch auf Hebammenbetreuung – unabhängig vom Gewicht des Kindes. Doch viele Forderungen bleiben offen.
Gemeinsam mit anderen Organisationen fordert Romaniewicz mit der Initiative „Mut zeigen“, dass der Anspruch auf Hebammenbetreuung bereits ab Feststellung der Schwangerschaft gelten soll – ebenso wie ein Kündigungsschutz für betroffene Frauen. Zudem fordern sie eine Ausweitung des Mutterschutzes auf alle Schwangerschaftsverluste ab einer gewissen Schwangerschaftswoche – wie es etwa Deutschland seit Kurzem vorsieht. Dort wurde die Grenze für den Mutterschutz im Falle einer „Fehlgeburt“ kürzlich auf die 13. Schwangerschaftswoche gesenkt.
Unterstützungsangebote bei Schwangerschaftsverlusten
- Verein Rechte für Sternchenmamas
- Verein 12 Wochen
- Verein Augenblick
- Verein Nabhinadi
- Verein Regenbogen