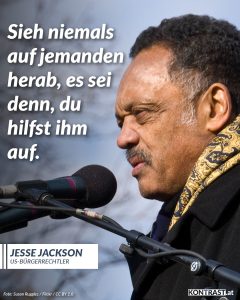Unser Energiesystem mitsamt den Leitungen und der Infrastruktur wird immer kleinteiliger und dezentraler – und damit teurer. Die Kosten dafür tragen in Österreich zu über 90 Prozent die Haushalte und Unternehmen mit ihren Netzgebühren. Kraftwerke, die in das Netz ihren Strom einspeisen, zahlen nichts. Noch, denn die Bundesregierung will das ändern. Geht es nach AK und SPÖ sollen dabei Privathaushalte mit standardmäßigen PV-Anlagen ausgenommen werden. Entscheiden wird die unabhängige Behörde E-Control.
Unser Energiesystem wird kleinteiliger und dezentraler. Immer mehr Menschen setzen auf Eigenversorgung mit Photovoltaik – und tragen somit maßgeblich zum Klimaschutz und dem Erreichen der Klimaziele bei. Denn bis 2040 will Österreich klimaneutral sein. Da wird jede Kilowattstunde erneuerbarer Strom dringend gebraucht. Obendrein hat Sonnenstrom die mit Abstand niedrigsten Produktionskosten.
Die erneuerbare Zukunft ist also nachhaltig und fast ohne Kosten? Nicht ganz. Denn während die Produktionskosten rapide sinken, steigen die Kosten für die Netze. Arbeiterkammer-Energieexperte Joel Tölgyes rechnet vor, dass sich die Netzkosten in den kommenden Jahren verdoppeln könnten. Zahlen müssen das laut Tölgyes aktuell vor allem die Endkund:innen von Strom, also Haushalte und Unternehmen. Sie tragen 94 % der gesamten Kosten. Einspeiser, also Kraftwerke, zahlen nur rund 6 %.
Instandhaltung und Ausbau der Energienetze wird immer teurer
Die höheren Netzkosten lassen sich zum Teil nachvollziehbar erklären: Die Instandhaltung und der Ausbau der Netze werden teurer. Auch Komponenten wie Transformatoren und Leitungen kosten mehr. Der wachsende Stromverbrauch und die dezentrale Einspeisung aus erneuerbaren Quellen erhöhen zusätzlich die Kosten.
Die Netzbetreiber müssen der unabhängigen Behörde E-Control regelmäßig ihre Kosten melden. Diese legt dann fest, wie hoch die Gebühren fürs Netz sind und wer wie viel zahlen muss, um die Kosten zu decken und Investitionen zu ermöglichen.

Die steigenden Kosten treffen vor allem Mieter:innen und Menschen mit geringem Einkommen
Immer mehr Menschen produzieren und verbrauchen ihren eigenen Strom. Das macht sie nicht nur weniger abhängig von Energiekonzernen, sondern reduziert auch ihre Netzkosten. Wer selbst produzierten Strom verbraucht, reduziert seinen Strombezug und damit seinen Anteil an den Netzgebühren. Im Umkehrschluss bedeutet das aber: Die verbleibenden Kosten verteilen sich auf weniger Haushalte – meist auf jene ohne eigene Einspeisemöglichkeiten, etwa Mieter:innen oder Menschen mit geringem Einkommen. “Das ist eine klare soziale Schieflage zu Lasten jener, die weniger Vermögen und Einkommen haben”, sagt dazu Energieexperte Tölgyes.
Eingespeister Strom kommt hauptsächlich von Energieunternehmen
Die Bundesregierung plant daher im neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) eine Reform: Künftig sollen auch Einspeiser mehr Netzgebühren zahlen. Als Einspeiser gelten alle, die über einen Zählpunkt ins Netz einspeisen. Rund 75 % des eingespeisten Stroms kommt aus Wasser- oder Windkraft, rund 15 % aus thermischen oder Biomasse-Kraftwerken. Etwa 10 % kommt aus Photovoltaikanlagen, davon wiederum nur ein Teil von privaten Haushaltsanlagen.
Die genaue Ausgestaltung wird von der unabhängigen E-Control festgelegt. Derzeit verhandeln SPÖ, ÖVP und Neos über die Details. Für den Beschluss ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament erforderlich – möglich mit Unterstützung der Grünen oder der FPÖ.
SPÖ und AK fordern: Energiekonzerne sollen mehr zur Finanzierung beitragen
Die Grünen lehnen die geplanten Gebühren ab. Ex-Klimaministerin Leonore Gewessler erklärte auf „X“, dass Produzenten nicht bestraft werden dürften. Aus der SPÖ kommt hingegen Zustimmung. Die Partei fordert, dass vor allem kommerzielle Einspeiser, also Energieunternehmen wie Verbund oder EVN, stärker zur Finanzierung beitragen und damit die Stromkund:innen entlastet werden. Privathaushalte mit einer standardmäßigen PV-Anlage sollen als Einspeiser aber nicht betroffen sein. Die genaue Lastenverteilung muss jedoch die E-Control definieren, die als unabhängige Behörde dafür zuständig ist.
Noch ist offen, wie sich die E-Control entscheiden wird – ob alle Einspeiser zahlen müssen, oder nur größere Erzeugungsanlagen, wie es die SPÖ und die Arbeiterkammer fordern. Um die steigenden Ausgaben abzufedern, plant die Regierung jedenfalls auch flankierende Maßnahmen. So finden sich im Regierungsprogramm längere Abschreibungszeiträume und mögliche Finanzierungsoptionen über die Bundesfinanzierungsagentur OeBFA.