Wie viel wir beim Einkaufen bezahlen, hängt nicht nur vom Produkt ab – sondern oft auch vom Geschlecht. Denn der Griff ins Regal ist für Frauen meist teurer als für Männer. Das liegt in diesem Fall nicht etwa am Einkommen, sondern an der sogenannten „Pink Tax“ – einer unsichtbaren Steuer, die speziell Konsumentinnen trifft. Der Vergleich verschiedener Alltagsprodukte zeigt: dasselbe Produkt, zwei Zielgruppen, unterschiedliche Preise – und das bereits ab dem Kindesalter.
Ein kurzer Blick ins Regal reicht, um die Unterschiede zu erkennen: Rasierer in der Männerabteilung um 2,24 Euro pro Stück. Der gleiche Rasierer – nur in rosaroter Verpackung „für Frauen“ – liegt bei 3,36 Euro. Der Preisaufschlag: 50 Prozent. Dasselbe Muster zeigt sich bei Gesichtscremes, Rasierschaum oder Kinderspielzeug. Zufall ist das keiner. Denn dahinter steckt eine gezielte Strategie vieler Unternehmen: die sogenannte Pink Tax, eine unsichtbare Frauensteuer.
Frauen zahlen für vergleichbare Produkte oft deutlich mehr als Männer – nicht wegen höherer Qualität, sondern allein wegen der Zielgruppe. Es handelt sich bei der „pinken Steuer“ allerdings nicht um eine echte Steuer, sondern um einen Aufpreis, den Firmen auf weiblich vermarktete Produkte schlagen. Wie groß diese Unterschiede sind, zeigt unter anderem eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer Salzburg (AK). Die Ergebnisse zeichnen laut AK ein „erschreckendes Bild“.

Friseurtermin, Tagescremes, Duschgels: 50-prozentiger Preisaufschlag für Frauen
In 8 von 10 Salzburger Friseursalons gibt es unterschiedliche Preise für Frauen und Männer – selbst bei identischen Leistungen wie bei Kurzhaarschnitten. Für den gleichen Zeitaufwand zahlen Frauen mit kurzen Haaren im Schnitt 38,70 Euro, Männer hingegen nur 29,20 Euro. „In diesem Fall spricht man von Gender Pricing“, betont Martina Plazer vom Konsumentenschutz der AK Salzburg.
„Die Preise werden nicht an die angebotenen Leistungen geknüpft, sondern richten sich nach dem Geschlecht der Kundschaft.“
Große Preisunterschiede gibt es auch bei Hygieneartikeln: Frauen zahlen für vergleichbare Artikel oft spürbar mehr als Männer. Spitzenreiter bei den Preisaufschlägen für Frauen sind laut einer AK-Erhebung Einwegrasierer mit 68,1 Prozent, gefolgt von Tagescremen (55 %) und Duschgel (51,4 %).
Rosa Frühstücksset um 23 Prozent teurer
Welche Auswirkungen geschlechtsspezifische Preisunterschiede auf Frauen haben, untersuchten drei Schülerinnen der BHAK St. Pölten genauer. Im Rahmen ihrer Diplomarbeit verglichen Lena Höld, Kathrin Thanner und Emma Kranawetter stichprobenartig die Preise alltäglicher Produkte für Männer und Frauen bei zwei bekannten Drogeriemarktketten. Der Blick ins Regal zeigte: Die „Pink Tax“ ist im Handel allgegenwärtig und kostet Frauen jedes Jahr hunderte Euros.
Bereits Kinderspielzeuge sind von der Preisdiskriminierung betroffen. So kostet etwa ein Frühstücksset, das Charaktere einer bekannten Kinderserie abbildet, in blau 12,99 Euro und in pink 15,99 Euro. Ein Preisaufschlag von 23 Prozent.

Gezielte Tricks verschleiern Preisdiskriminierung
Die konkreten Preisunterschiede sind dabei häufig nicht auf den ersten Blick sichtbar. Denn Unternehmen setzen gezielte Tricks ein, um die Geschlechterdiskriminierung zu verschleiern. Oftmals versuchen Hersteller, den Preisaufschlag durch verschiedene Füllmengen oder durch das Abändern der Form der Verpackung zu vertuschen.
„Bei der Marktanalyse war es sehr schwierig herauszufinden, welcher Rasierer das Gegenstück zum Frauenrasierer ist und umgekehrt. Weil es durch die Mengenbezeichnungen so versteckt war“, erklärt Emma Kranawetter. Dabei fiel den Schülerinnen auch auf, dass bei Rasierprodukten die Preisangaben im Kleingedruckten unterschiedlich formuliert sind – abhängig davon, ob es sich um die weibliche oder männliche Variante handelt. Durch diese uneinheitlichen Umrechnungsfaktoren wird ein direkter Preisvergleich erschwert – möglicherweise mit dem Ziel, die „Pink Tax“ zu verschleiern.
Wie Unternehmen von gesellschaftlichen Klischees profitieren
In jedem Fall profitieren Unternehmen davon, Männer und Frauen gezielt als getrennte Zielgruppen anzusprechen – eine Strategie, die als Gendermarketing bekannt ist. Frauen gelten dabei häufig als zahlungsbereiter, besonders bei bestimmten Konsumgütern. Gesellschaftliche Rollenbilder und Erwartungen beeinflussen dabei, welche Produkte als „typisch weiblich“ oder „typisch männlich“ vermarktet werden – und die Werbung verstärkt diese Klischees. Besonders deutlich zeigt sich das bei Kinderprodukten, die oft klar in Rosa und Blau gekennzeichnet sind: Glitzereinhörner für Mädchen, Bagger und Dinosaurier für Jungen – und das auf Tassen, Fahrradhelmen, Pullover und Zahnpasta.
Doch mit diesen Unterschieden werden nicht nur Farben, sondern auch bestimmte Eigenschaften, Interessen und Lebensstile vermittelt. Wer schon früh lernt, dass das äußere Erscheinungsbild im Vordergrund steht, investiert später womöglich mehr in Kosmetik und Pflegeprodukte – ein Vorteil für Unternehmen, die so von geschlechtsspezifischem Konsum langfristig profitieren.
Was im Regal beginnt, verstärkt bestehende Ungleichheiten
Erkenntnisse zur „Pink Tax“ sind wie ein weiteres Puzzle-Teil: Sie fügen sich ein in das Gesamtbild geschlechtsspezifischer Benachteiligung. Denn nach wie vor sind Frauen im Arbeitsleben klar im Nachteil gegenüber Männern – vor allem beim Einkommen und in der Pensionshöhe. Diese Preisunterschiede tragen zur wirtschaftlichen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern bei und verstärken somit bestehende Ungerechtigkeiten.
Einfach erklärt: Was Feministinnen wollen – und warum auch Männer profitieren


































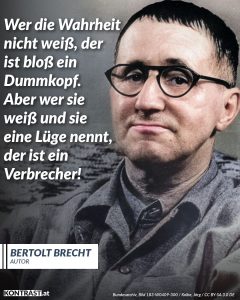

Das ist nur die halbe Wahrheit, wenn man sich die Herrnabteilung ansieht leidet diese vor allem durch Monotonie und Einfältigkeit.
–
Und das wollen Frauen zu recht nicht, ich auch nicht.
–
Das führt dazu das mehr Regalflächen benötigt werden, pro Angebot weniger gekauft wird, weil es ein vielfältiger ist, und das versucht dann auch Mehrkosten.
–
Die Einfältigkeit und Monotonie bei den Herrnprodukten ist an Phantasielosigkeit nicht mehr zu überbieten, wo es geht greife ich trotz etwas treueren Preisen auf Pink Produkte zurück.
–
Oft geht es leider nicht anders wie bei Schuhen, wenn ich einen Traktor will gehe ich ins Lagerhaus. Bei Bekleidung, fast durchgehend 100 Prozent Baumwolle, Baumwolle ist alles andere als Nachhaltig und obendrein darf ich das aus medizinischen Gründen nicht tragen. Somit bleibt gar nichts anderes übrig als in der Pink-Abteilung etwa passendes zu finden. Bei der Bekleidung und Schuhen wäre mehr Unisex wünschenswert.
–
Duschgel da gibt es die Wahl eines zu nehmen aus der Herrnabteilung um 1,99 das einem Abschmiermittel alle ehren macht, in wenigen Tagen verbraucht ist, oder in der Damenabteilung um 19 Euro, das für mehr als ein Monat reicht. Quizfrage was ist am Ende billiger?
–
Bei den Rasieren gibt es Modelle in der Frauenabteilung für die es in der Herrnabteilung gar keine altarnative gibt. Diese Produkt zeichnet sich durch Langlebigkeit und Nachhaltigkeit aus, darf so etwas etwas mehr kosten. ganz sicher!
–
Friseur, eine Blick in die Anatomie würde genügen, Frauenhaare sind anders als Herrenhaare, Wenn die Frauen Herrnpreise wollen bräuchte es eine Gentherapie, den wenigsten würde eine Bart besonders gefallen was eine Folge einer solchen Therapie wäre. Ganz so einfach ist es auch hier nicht.
–
Primär stimmt die Aussage, etwas tiefer geblickt schaut das schon etwas anders aus.