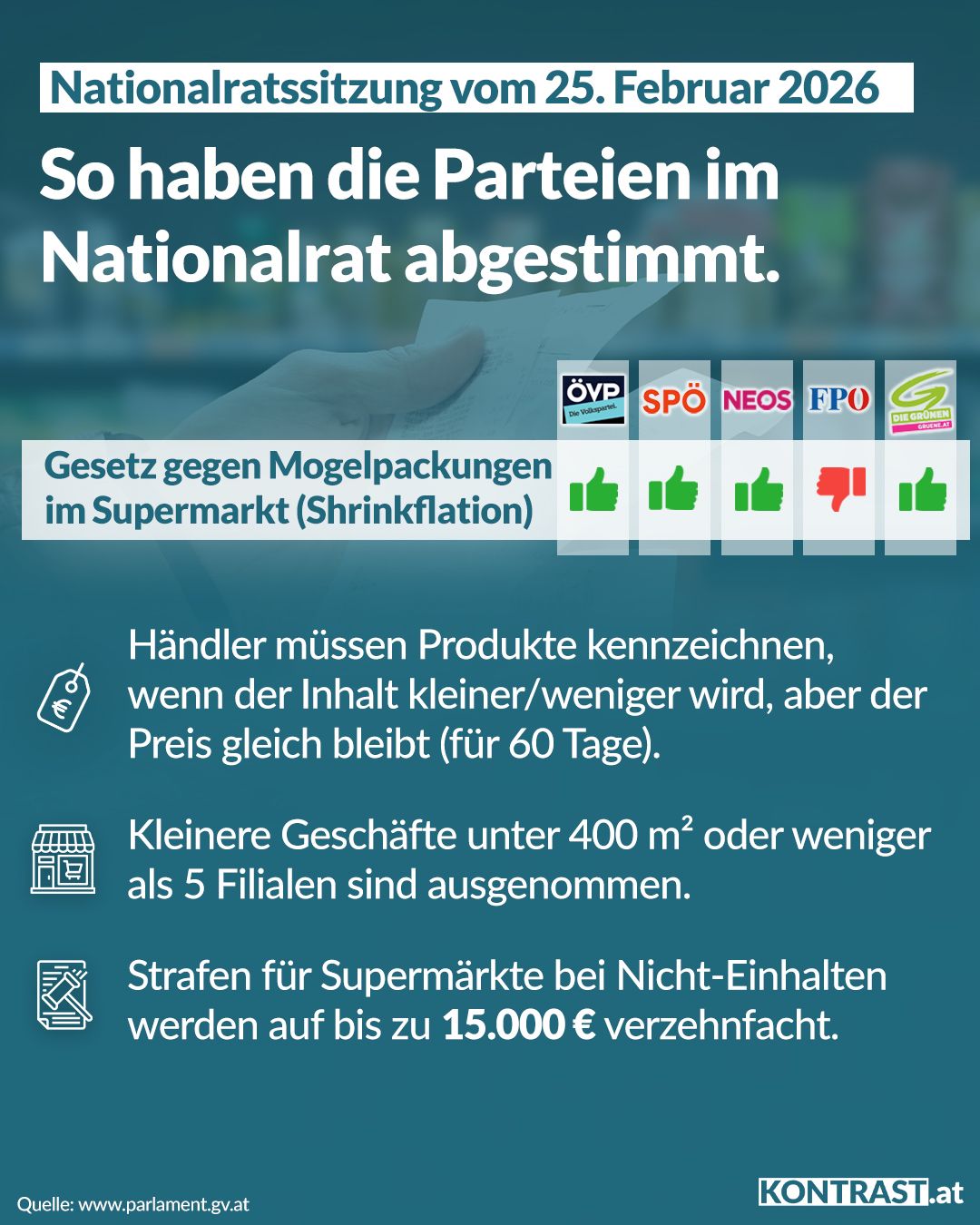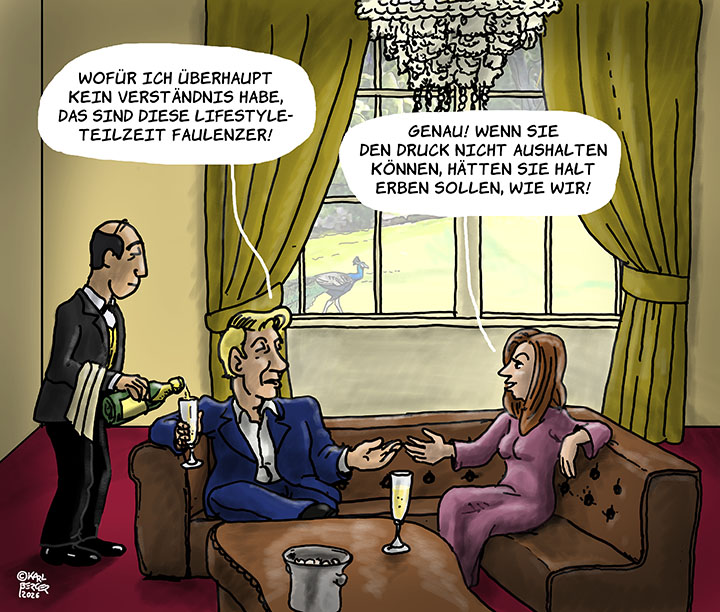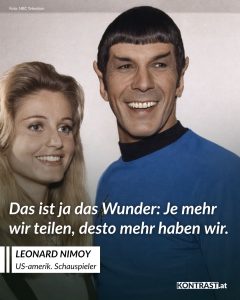Bis Anfang der 1960er-Jahre gehörte der Aralsee zu den größten Seen der Welt. Seine nahezu vollständige Austrocknung innerhalb weniger Jahrzehnte zählt zu den größten vom Menschen verursachten Umweltkatastrophen. In Usbekistan und Kasachstan herrschen rund um den See Trockenheit, Versalzung und Sandstürme. Doch seit einigen Jahren bemühen sich Länder auf der ganzen Welt gemeinsam, den Aralsee zu retten. Mit Erfolg: Groß angelegte Wasserzufuhr, robuste Sträucher und ein Damm lassen den Wasserspiegel und die Fischpopulation wieder steigen.
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war der Aralsee der viertgrößte See der Erde. Mit 68.000 Quadratkilometern hatte er etwa 80 Prozent der Fläche Österreichs. In den 1960er-Jahren wollte die Sowjetunion dann die Flüsse Amudarja und Syrdarja für die Landwirtschaft nutzen und leitete sie zur Bewässerung der riesigen Baumwoll- und Reisfelder um. Damit versiegte aber der Wasserzufluss und der Aralsee verlandete nach und nach, sodass heute nur noch 10 Prozent der ursprünglichen Wasserfläche erhalten sind. Wo früher gefischt werden konnte, breitet sich nun die Aralkum-Wüste aus – eine der jüngsten der Erde. Sie ist bereits über 62.000 Quadratkilometer groß und wächst weiter. Hitze, salzhaltige Böden und starke Sandstürme machen die Gegend um den Aralsee heute zu einer lebensfeindlichen Umgebung.
Austrocknung brachte Sandstürme und giftigen Staub
Mit der fortschreitenden Austrocknung begann ein Teufelskreis: Das restliche Wasser wurde immer salziger, wodurch viele Fisch- und Pflanzenarten verschwanden. Ohne den See als natürlichen Temperaturregler wird es im Sommer über 42 Grad Celsius heiß und im Winter extrem kalt. Gleichzeitig bildet sich eine Salzkruste auf dem Boden, die Pflanzenwachstum verhindert. Starke Winde wirbeln Sand und Salz vom ausgetrockneten Boden auf. Der feine Staub ist nicht nur schlecht für die Atemwege, er enthält auch schädliche Pestizidrückstände aus der Landwirtschaft. Die heftigen Sandstürme tragen die belasteten Partikel über hunderte Kilometer und gefährden so Menschen, Tiere und die gesamte Umwelt. Ganze Dörfer wurden bereits vom Sand verschluckt.
1,6 Milliarden Kubikmeter Wasser aus Nachbarländern für den Aralsee
Die Wasserversorgung in der Region hängt von zwei Flüssen ab: Dem Amudarja – er fließt durch Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan und Afghanistan – und dem Syrdarja – er versorgt Kasachstan, Tadschikistan und Usbekistan mit Wasser. Weil so viele zentralasiatische Länder mit Wassermangel kämpfen, gibt es seit Jahren internationale Zusammenarbeit.
Seit 2017 gibt es beispielsweise den Internationalen Fonds zur Rettung des Aralsees oder die zwischenstaatliche Kommission für die Koordinierung der Wasserversorgung in Zentralasien. Letztere hat sich im Jänner 2025 in Duschanbe, Tadschikistan, getroffen. Dort wurde mitunter vereinbart, dass Kasachstan über Leitungen 11 Milliarden Kubikmeter Wasser zugeführt bekommt. 1,6 Milliarden Kubikmeter davon werden bis zum Frühjahr 2025 in den Aralsee fließen.
Schon 2024 leitete Kasachstan etwa 2,6 Milliarden Kubikmeter Wasser in den Aralsee ein. Zum Vergleich: 2022 waren es „nur“ 816 Millionen Kubikmeter.
Sträucher reichern Böden an und schützen vor Sandstürmen
Zudem setzt man in der Region um den Aralsee auf Begrünungsprojekte. Das Projekt „Oasis“ will seit 2021, mit Unterstützung aus US-Entwicklungsgeldern, den ehemaligen Seeboden vor weiterer Austrocknung schützen.
Seitdem pflanzt man auf 500 Hektar Land sogenannte Saxaul-Sträucher. Deren Wurzeln können bis zu 4.000 Kilogramm Sand halten. Wo andere Pflanzen verdorren, entfaltet der Saxaul-Strauch besondere Widerstandskraft. Statt großer Blätter besitzt er winzige, schuppenförmige Blättchen, die kaum Wasser verdunsten lassen. Die Pflanze wirkt mehrfach gegen Desertifikation – also gegen Wüstenbildung. Sie schützt vor den Auswirkungen von Sand- und Salzstürmen und ist salztolerant. Die Wurzeln halten und stabilisieren leicht erodierte Böden und reichern sie mit Humus an.
Kok-Aral-Staudamm lässt Wasserspiegel binnen weniger Monate steigen
Ein weiteres internationales Projekt, das den Aralsee erhalten soll, ist der Kok-Aral-Staudamm. 2005 baute man, finanziert durch die Weltbank, einen 12 Kilometer langen Staudamm. Er soll verhindern, dass Wasser abfließt. Der Damm ließ den Wasserspiegel des Sees binnen weniger Monate um über drei Meter ansteigen. Seither vergrößert sich die Fischpopulation im See wieder und die lokale Wirtschaft erlebte einen Aufschwung.
Die Stadt Aralsk, früher Zentrum der Fischerei um den See ist heute immer noch 30 Kilometer vom Ufer entfernt. Mit den Projekten zur Rettung des Aralsees schöpfen die Bewohner wieder Hoffnung, weil nun zunehmend in die Stadt und die Region investiert wird.
Aralsee wieder Lebensraum für Fische – Fischfang nimmt zu
Dass sich der See und das Ökosystem langsam erholen, zeigt mitunter der wieder zunehmende Fischfang. Durch Austrocknung und Fischsterben sank der Fang zwischen 1957 und 1987 von 48.000 Fischen pro Jahr auf Null.
Seitdem es den Kok-Aral-Damm gibt, hat sich der Salzgehalt des verbliebenen Wassers normalisiert. Die Fischpopulation im See erholt sich seitdem wieder. So konnte man die Fisch-Fanggrenzen 2018 auf 8.200 Tonnen erhöhen. Eine Steigerung von 600 % gegenüber 2006.
Solaranlagen in Ostafrika: 120 Millionen Haushalte könnten Zugang zu Strom erhalten