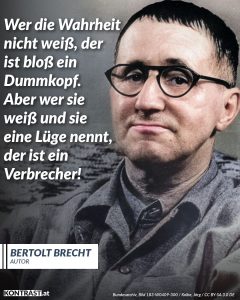Hier können Sie die AI-generierte Audioversion dieses Artikels anhören.
Im Podcast „Armutszeugnis“ beantwortet die Politikwissenschaftlerin Sabine Nuss die Frage, warum es gerade einen starken Rechtsruck gibt: Unsicherheit und wachsende Ungleichheit geben rechten Parteien Zulauf. Viele, die Angst vor einem sozialen Abstieg haben, fühlen sich von rechten und rechtsextremen Parteien angesprochen.
Sabine Nuss war im August 2025 zu Gast im Podcast „Armutszeugnis“ der Rosa Luxemburg-Stiftung. Nuss ist Politikwissenschafterin, Autorin und war selbst einst Leiterin der Politischen Kommunikation der Stiftung. Im Podcast fasst Nuss aktuelle Studien zusammen, die zeigen, wie Krisen – zum Beispiel die Inflation, die Energiekrise oder auch politische Konflikte – mit dem Erstarken rechter bis rechtsextremer Parteien zusammenhängen. Ihre zusammenfassende These: Vor allem, wenn sich Menschen vom Staat im Stich gelassen oder benachteiligt fühlen, wählen sie rechts. Sparpolitik und wenige wirtschaftliche Sicherheit für den Einzelnen führen genau dazu. In neoliberaler Wirtschaftspolitik sieht Nuss folglich die Wurzel des Problems.
In den späten 1970er-Jahren wurde neoliberale Politik populär. Federführend waren in den USA Ronald Reagan und in Großbritannien Margaret Thatcher. Der Kern ihrer Politik: niedrigere Steuern, weniger staatliche Regeln und mehr Vertrauen darauf, dass der Markt sich selbst gut regelt. Damit lösten sie die bis dahin dominierende Politk nach dem Ökonomen John Maynard Keynes ab, die auf einen starken Staat zur Steuerung der Wirtschaft setzte.
Die Folge war, dass die Kluft zwischen Arm und Reich größer wurde und Unternehmen sowie Kapitalbesitzer immer mächtiger wurden.
Sparpolitik verstärkt das Gefühl, allein gelassen zu werden
Seit den 1990er-Jahren sind viele europäische Regierungen nachgezogen. Sie haben unter dem Schlagwort „Effizienz“ öffentliche Leistungen gekürzt – mit spürbaren Folgen für den Alltag. Und das überall in Europa. Man hat Krankenhäuser geschlossen, Buslinien eingestellt, Zugverbindungen gestrichen, Behörden zusammengelegt, Gesundheitsleistungen gekürzt. Für viele bedeutete das: längere Wege, schlechtere Versorgung, höhere Kosten.
Ein Beispiel aus Italien verdeutlicht diese Dynamik: Dort stieg die Zustimmung zu rechten Parteien deutlich, nachdem Poststellen und Buslinien in kleinen Gemeinden gestrichen wurden. Nuss beobachtet ähnliche Muster auch in Deutschland.
Dort, wo der Staat sich zurückzieht, bleiben Frust und ein Gefühl, im Stich gelassen zu werden. Rechte Parteien nutzen genau diese Stimmung.
Mit Angst wird Politik entschieden und gemacht
Wähler:innen rechter bis rechtsextremer Parteien sehen sich wirtschaftlich oft schlechter gestellt. Politikwissenschafterin Nuss hat sich hier vor allem mit der deutschen Wahlbevölkerung befasst. 37 % der AfD-Wählenden in Deutschland halten ihre wirtschaftliche Situation für schlecht.
Die deutsche Ökonomin Isabella Weber ging angesichts dieser Einschätzung sogar mit der Forderung reagiert, eine antifaschistische Wirtschaftspolitik zu betreiben.
„37 % der Wähler:innen der extremen Rechten in Deutschland halten ihre wirtschaftliche Situation für schlecht. Wir brauchen dringend eine antifaschistische Wirtschaftspolitik, die die Lebenshaltungskostenkrise angeht und die Menschen zurückgewinnt“, fordert Isabella Weber.
In Österreich sind die Motive ähnlich. Ein Grund, warum die FPÖ bei der Nationalratswahl im September 2024 so hohe Ergebnisse erzielte, war die wirtschaftliche Unzufriedenheit vieler Menschen. Beim Thema Teuerung war die FPÖ besonders unter jener Gruppe stark, die sich wegen der hohen Inflation stark einschränken mussten.
Der ständige Blick nach unten: Die Furcht vor dem Abstieg
Neoliberale Politik hat laut Sabine Nuss eine Gesellschaft geschaffen, in der viele Menschen glauben, jederzeit in die Armut abrutschen zu können. Auch jene, die bisher nicht von Armut betroffen waren, leben mit der Angst vor steigenden Mieten, vor ständigem Zurückstecken oder davor, den Job zu verlieren.
Nuss verweist auf Studien, die zeigen: Schon die Wahrnehmung, dass es „um einen herum“ schlechter wird, reicht aus, dass Menschen Angst vor dem eigenen Abstieg haben. Zu befürchten, selbst die oder der Nächste zu sein, macht empfänglich für Neiderzählungen, für negative Zukunftsdarstellungen und für einseitige Schuldzuweisungen.
Rechte Parteien nutzen das gezielt. Sie nutzen das reale Problem der sozialen Ungleichheit, aber nicht, um es zu lösen, sondern um Missgunst und Verteilungskämpfe nach unten weiter zu befeuern. Sie machen sozial Schwächere oder geflüchtete Menschen verantwortlich für wirtschaftliche Schieflagen und Ungerechtigkeiten.
Stimmenanteile rechtsextremer, rechtspopulistischer und anti-demokratischer Parteien bei den Europawahlen 2024
Rechtswähler:innen sehen im Nicht-Aufstieg eigene Niederlage – das frustriert oder macht sogar wütend
Selbst wenn sich die eigene finanzielle Lage nicht verschlechtert, fühlt es sich laut Nuss für viele frustrierend an, wenn ein paar wenige immer reicher werden. Man selbst gibt sich Mühe, arbeitet hart, und trotzdem passiert wenig, während andere scheinbar mühelos aufsteigen. Dieses Gefühl nennt man relative Abwertung: Es geht nicht darum, dass man wirklich weniger hat als früher, sondern darum, dass die Unterschiede zu anderen Menschen größer werden. Dieses Gefühl wird bestärkt, wenn die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufgeht.
Neoliberale Ideologie hat das Denken gestärkt, dass jede:r für das eigene Glück und den eigenen Erfolg verantwortlich ist. Das hat gleichzeitig die Solidarität zwischen einzelnen Personen zurückgedrängt, weil die Sichtweise vorherrscht: Jede:r ist selbst schuld am eigenen Misserfolg. Staatliche Maßnahmen, die eigentlich benachteiligten Gruppen helfen sollen, erscheinen so schnell als Belastung.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an