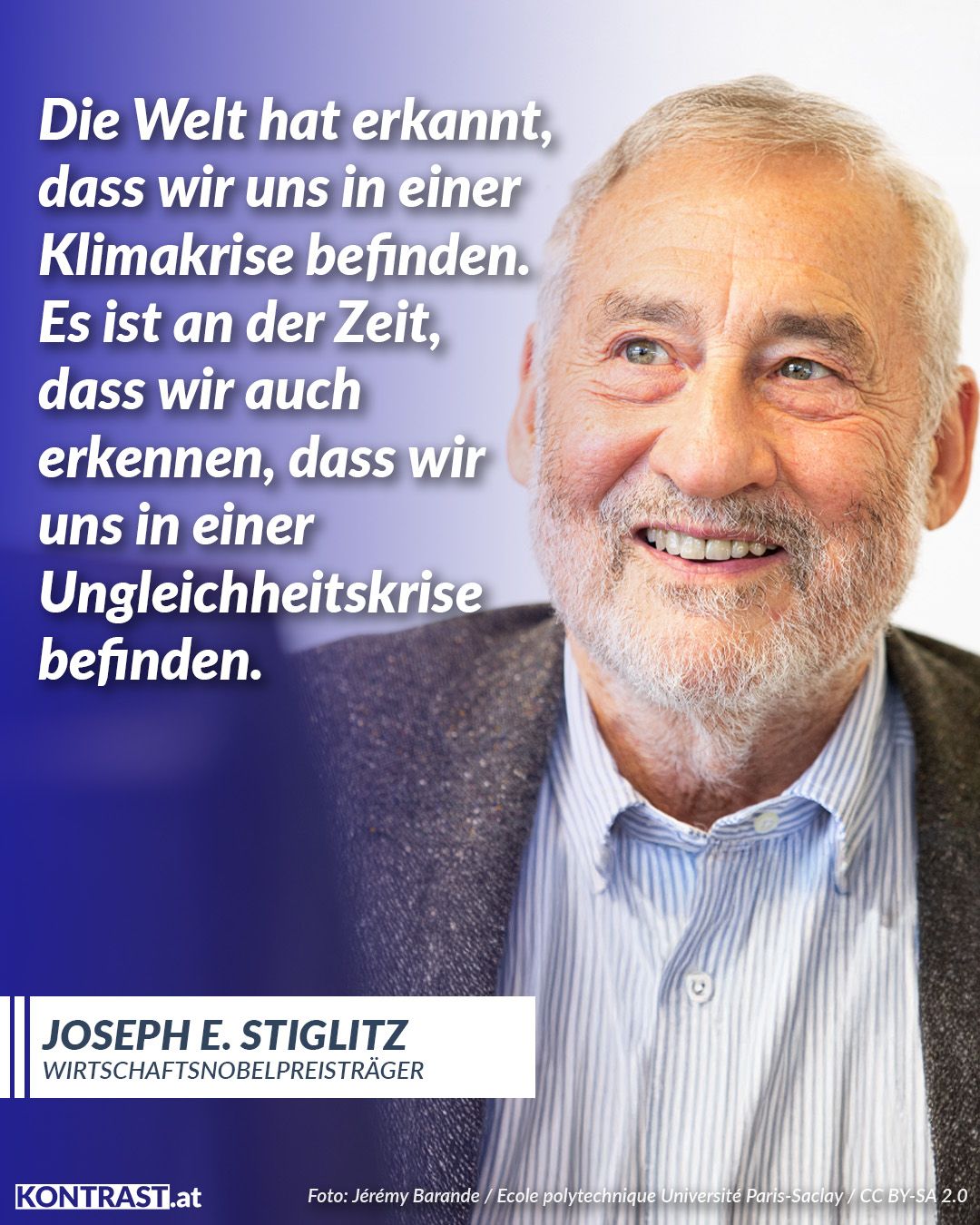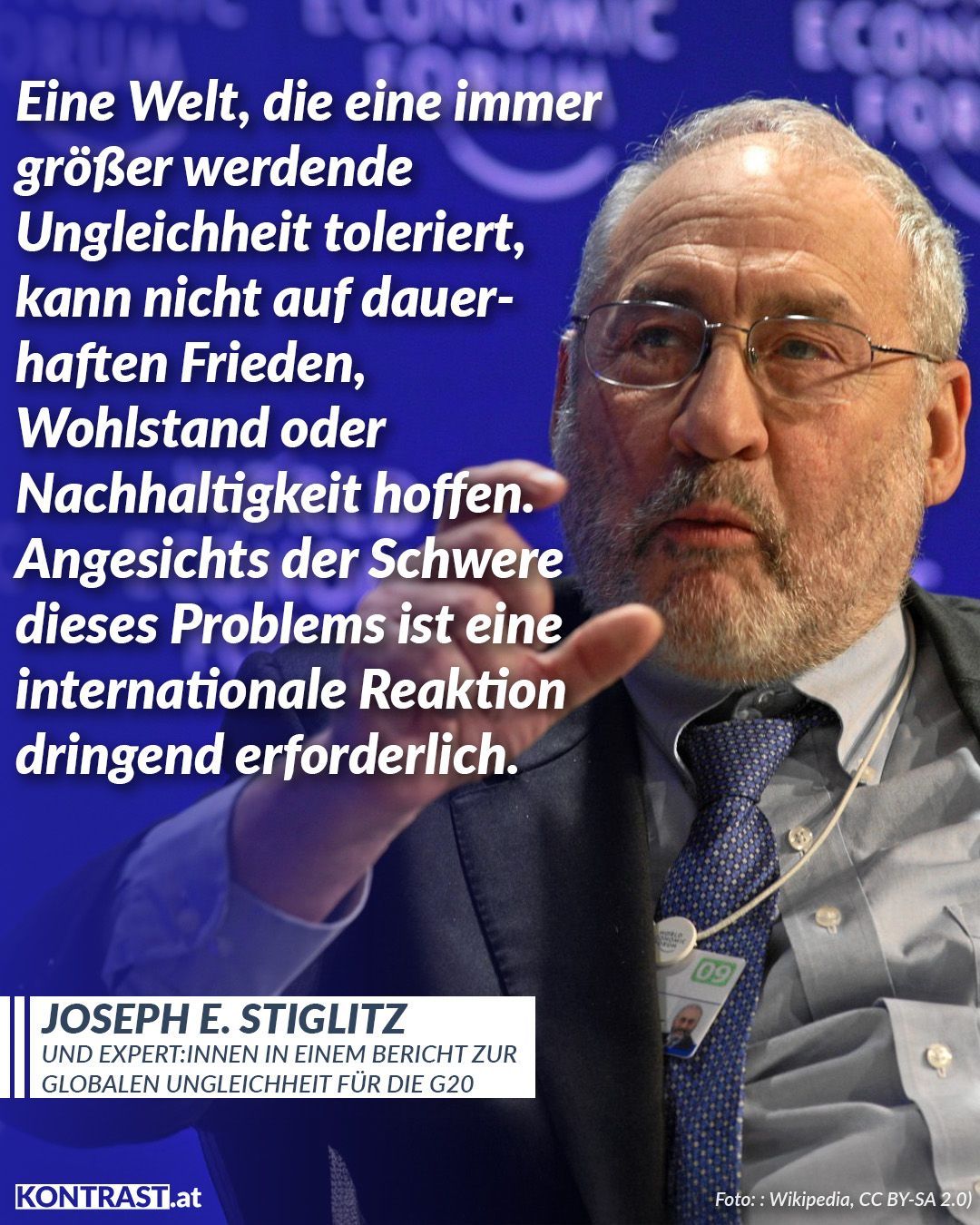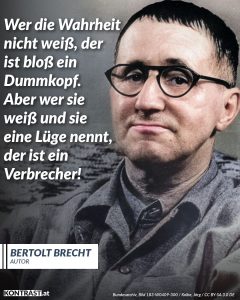Hier können Sie die AI-generierte Audioversion dieses Artikels anhören.
Ein neuer Expert:innenbericht unter der Führung von Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph E. Stiglitz warnt vor einer globalen Ungleichheitskrise, die am Ende Demokratie, Wirtschaft und Klima bedroht. Extreme Vermögenskonzentration und wachsender Hunger sind die Phänomene, die zeigen, wie weit die Schere zwischen Überreichtum und Armut auseinandergeht. Das reichste Prozent vereint fast die Hälfte des neu geschaffenen Vermögens – während Milliarden kaum ihre Grundbedürfnisse decken können. Der Bericht sagt aber: Diese Entwicklung ist politisch gemacht und damit veränderbar.
Ein unabhängiges Expertengremium der G20 warnt vor einer „Ungleichheitskrise“. Der „Außerordentlichen Ausschuss unabhängiger Expertinnen und Experten für globale Ungleichheit“, wie das Gremium heißt, unter Leitung des Ökonomen und Nobelpreisträgers Joseph E. Stiglitz hat im Auftrag der südafrikanischen G20-Präsidentschaft einen umfassenden Bericht zur globalen Ungleichheit vorgelegt. Die Autor:innen kommen zu dem Schluss, dass extreme Ungleichheit kein Naturereignis ist, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen.
Der Bericht zeichnet ein Bild massiver Konzentration von Einkommen und Vermögen. In 83 Prozent der Staaten liegt die Einkommensungleichheit über dem vom Weltbank-Standard definierten Schwellenwert für „hohe Ungleichheit“. Rund 90 Prozent der Weltbevölkerung leben damit in Gesellschaften mit stark ungleicher Verteilung.
Global ist die Einkommensungleichheit zwischen allen Menschen seit dem Jahr 2000 zwar leicht gesunken, vor allem wegen des Wachstums in China. Sie bleibt jedoch auf einem sehr hohen Niveau.
Beim Vermögen sind die Unterschiede noch drastischer: Seit 2000 hat das reichste Prozent der Weltbevölkerung 41 Prozent des neu geschaffenen Vermögens auf sich vereint. Die ärmere Hälfte der Menschheit nur ein Prozent. Gleichzeitig gelten 2,3 Milliarden Menschen als mäßig oder stark von Hunger betroffen.
Starke Ungleichheit bei Vermögen und Einkommen gefährdet auch Demokratien
Ungleichheit bleibt damit nicht nur eine moralische Frage, sondern wird zur systemischen Gefahr. Das Gremium verweist auf Studien, nach denen Staaten mit hoher Ungleichheit ein deutlich höheres Risiko für demokratischen Rückschritt tragen.
Wo Vermögen, Medien und politische Einflusskanäle in den Händen weniger liegen, verschieben sich die Spielregeln. Reiche Akteure können Wahlkämpfe finanzieren, Gesetzgebung beeinflussen und über klassische wie soziale Medien Debatten prägen. Die Expert:innen sehen darin einen Nährboden für Autoritarismus.
Ungleichheit schwächt auch die Volkswirtschaft als Ganzes
Auch ökonomisch wirkt sich Ungleichheit nach Ansicht der Autor:innen negativ aus. Menschen mit geringem Einkommen geben einen Großteil ihres Geldes unmittelbar aus. Wenn ihr Anteil am Gesamteinkommen sinkt, schwächt das die gesamtwirtschaftliche Nachfrage.
Zugleich untergräbt Armut Investitionen in Bildung, Gesundheit und Ernährung. Wer krank ist, hungert oder seine Kinder nicht in eine gute Schule schicken kann, wird sein Potenzial nicht ausschöpfen. Das schmälert langfristig Produktivität und Wachstum.
Die Reichsten der Welt schaden unserem Klima mit Luxuskonsum und Investment-Verhalten
Hinzu kommt der ökologische Aspekt. Der Bericht betont, dass Superreiche überproportional zum CO₂-Ausstoß beitragen. Luxuskonsum, große Vermögen und hohe Renditeerwartungen treiben ressourcenintensive Produktions- und Finanzstrukturen. Die Folgen – Klimaextreme, Ernteausfälle, Gesundheitsrisiken – treffen jedoch häufig jene Regionen, die am wenigsten zur Krise beigetragen haben. Ungleichheit wirkt damit als Beschleuniger der Klimakrise.
Die Autor:innen machen sowohl historische als auch aktuelle politische Treiber dieser Entwicklung aus. Kolonialismus, ungleiche Handelsstrukturen und rassistische Diskriminierung haben aus ihrer Sicht die Grundlagen für heutige Vermögensunterschiede gelegt.
In den vergangenen Jahrzehnten kamen wirtschaftspolitische Entscheidungen hinzu: Deregulierte Finanzmärkte, eine geschwächte Regulierung großer Konzerne, die Erosion von Gewerkschaften und sinkende Spitzensteuersätze zugunsten hoher Einkommen und Gewinne. Gleichzeitig wurde vielerorts öffentlicher Besitz abgebaut, während privates Vermögen stark gewachsen ist.
Handelsabkommen, Patentpolitik und Monopole hemmen Entwicklungs- und Schwellenländer
Handels- und Investitionsabkommen begrenzen nach Einschätzung des Gremiums den Handlungsspielraum vieler Entwicklungs- und Schwellenländer. Strenge Patentsysteme sichern Konzernen Monopolgewinne bei Medikamenten oder Klimatechnologien. Gleichzeitig ermöglichen Steuersümpfe multinationalen Konzernen und Superreichen, Gewinne und Vermögen vor der Steuer zu verstecken. Dies entzieht gerade armen Staaten wichtige Einnahmen, die sie für öffentliche Dienstleistungen und Klimaschutz benötigen.
Um dieser Dynamik zu begegnen, schlägt das Gremium eine neue Institution vor: ein „International Panel on Inequality“ (IPI). Dieses Gremium soll ähnlich wie der Weltklimarat IPCC arbeiten, jedoch mit Fokus auf Ungleichheit. Es würde keine eigene Forschung betreiben, sondern vorhandene Daten und Studien auswerten, Lücken benennen und in regelmäßigen Berichten Trends, Ursachen und Folgen von Ungleichheit darstellen.
Der Vorschlag von Stiglitz und Co. an die G20: ein Internationales Expert:innenrat, der Daten über Ungleichheit auswertet und Regierungen bereitstellt
Die Expertinnen und Experten betonen, dass das Panel unabhängig arbeiten und geographisch wie fachlich breit besetzt sein muss. Es soll Regierungen und internationalen Organisationen Entscheidungsgrundlagen liefern, ohne selbst politische Forderungen zu vertreten.
National empfehlen die Autor:innen eine Stärkung progressiver Steuern auf hohe Einkommen, Vermögen und Erbschaften, den Ausbau öffentlicher Dienstleistungen in Bildung, Gesundheit, Pflege und Verkehr sowie wirksame Mindestlöhne und Arbeitsrechte.
International plädieren sie für eine Reform des globalen Steuersystems mit wirksamer Mindestbesteuerung von Konzernen und Superreichen, für Schuldenerleichterungen, neue Sonderziehungsrechte des IWF und eine Neuausrichtung von Handels- und Patentrechten, insbesondere bei Medikamenten und Klimatechnologien.
Am Ende steht eine klare Botschaft: Extreme Ungleichheit ist kein unverrückbares Schicksal, sondern das Ergebnis politischer Weichenstellungen – und damit veränderbar. Für die G20, die den Großteil der globalen Wirtschaftsleistung und der Treibhausgasemissionen verantworten, wird der Umgang mit dem Bericht zum Test. Ob sie den Aufbau eines internationalen Ungleichheitsrats unterstützen und eigene Regeln ändern, entscheidet mit darüber, ob die Kluft zwischen Arm und Reich weiter wächst – oder ob eine gerechtere Verteilung von Wohlstand und Chancen möglich wird.