Der Film INLAND begleitet drei FPÖ-Fans vor und nach der Nationalratswahl 2017 und taucht dabei tief in deren Lebenswelt ein. Warum wählt man FPÖ? Die Regisseurin Ulli Gladik tritt mit den Leuten in einen Dialog auf Augenhöhe über die Themen, die sie bewegen: Der Unmut über „die Ausländer“ und der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit. Isabel Frey und Emanuel Salvarani haben mit der Regisseurin darüber gesprochen, warum es Menschen zur FPÖ zieht – und wieder von ihr weg.
Kontrast: Ihre ProtagonistInnen stammen aus dem roten Arbeitermilieu, doch jetzt sind sie FPÖ-Fans. Woher kam diese Abwendung von der sozialdemokratischen Politik?
Gladik: Viele meiner Gesprächspartner meinten, sie fühlten sich von der SPÖ nicht mehr gesehen und vertreten. Manche sagten:
„Früher sind PolitikerInnen noch vorbeigekommen bei uns und haben sich unterhalten; haben uns gefragt, wie es uns geht, und da konnte man auch mal was anbringen. Da waren sie mehr Teil von uns.“
Jetzt werden SPÖ-PolitikerInnen aber als völlig abgehoben erlebt. Im Film erzählt eine Dame, dass ihre Mutter als Alleinerziehende mit neun Kindern nach Wien gekommen ist und sofort eine Gemeindewohnung und einen Hausmeisterjob bekommen hat. Heute ist diese Dame aber schon seit ein paar Jahren arbeitslos. Es ist sehr schwierig für sie wieder einzusteigen, weil sie über 50 ist.
Wenn HC Strache höhere Löhne und billige Mieten verspricht, dann kommt das gut an. So etwas habe ich bei einer SPÖ-Veranstaltung in so einer Klarheit und Direktheit eigentlich lang nicht mehr gehört – und selbst wenn, dann würde es wahrscheinlich nicht geglaubt werden.
DIE „KLEINEN LEUTE“
Kontrast: Die ProtagonistInnen in ihrem Film behaupten immer wieder zu glauben, die FPÖ stünde für ihre sozialen Interessen ein. Wie schafft es die FPÖ, sich als „Partei der kleinen Leute“ darzustellen?
Gladik: Die FPÖ spricht eine ganz einfache Sprache. Im Film sagt HC Strache bei einer Rede am Viktor-Adler-Markt: „Am Ende des Monats habt ihr kein Geld mehr im Börserl. Ich werde darauf schauen, dass ihr euch mal wieder einen neuen Fernseher oder einen Urlaub leisten könnt. Und ich werde dafür sorgen, dass es Wohnungen um 350 und 250 Euro gibt.“

Sicher hetzen FPÖ-Funktionäre hauptsächlich gegen Migranten, aber sie sprechen auch sonst eine Sprache, die man leicht versteht. Sie schaffen es, komplexe Inhalte einfach auszudrücken. Die FPÖ gibt sich als Arbeiterpartei. Bei den Dreharbeiten habe ich gelernt:
Viele Leute empfinden sich als Arbeiter und Arbeiterinnen – selbst wenn sie Angestellte sind.
Kontrast: Gibt es denn heute noch eine Arbeiterklasse?
Gladik: Ja, auf jeden Fall. Da gehören auch viele Menschen in prekären Verhältnissen dazu: AkademikerInnen, die neuen Selbständigen und die Generation Praktikum. Es gehören aber auch Menschen dazu wie die Protagonistin im Film, die sagt, sie fühlt sich als Arbeiterin, weil sie etwas mit ihren Händen macht. Sie meint: „Das bin ich und das werde ich auch immer bleiben, egal ob ich angestellt bin oder nicht.“ Auch ein Herr, der eigentlich verbeamtet ist, fühlt sich als Arbeiter, weil er harte, körperliche Arbeit leistet.
Kontrast: Wie haben Sie Ihre ProtagonistInnen gefunden?
Gladik: Wir waren lange in FPÖ-Wahlsprengeln unterwegs und haben dort Leute angesprochen. Ich hätte am Anfang noch mehr Leute gehabt, die sich bereit erklärten mitzuwirken. Doch als wir dann zu drehen begonnen haben, haben viele Angst bekommen, vor der Kamera über ihre Arbeitsverhältnisse zu sprechen.
Für mich war es wichtig, nicht nur über das Thema „Ausländer“, sondern auch über andere Themen wie Arbeit zu sprechen. Niemand wollte über seine Arbeitsverhältnisse sprechen – aus Angst, den Job zu verlieren
TRAILER INLAND | by Ulli Gladik from Ulli Gladik on Vimeo.
Kontrast: Eine Strategie, die Arbeiterklasse zurückzugewinnen, wäre auf die Ausbeutung durch Konzerne und Großunternehmen aufmerksam zu machen. Im Gespräch mit einer Protagonistin bringen Sie selbst ähnliche Argumente ein und stoßen damit auf Unverständnis. Was ist falsch an dieser Strategie?
Gladik: Diese Dame sagte zu mir: „Ich weiß darüber [über Konzerninteressen] zu wenig, ich kann nur über mein Umfeld sprechen.“ Ein Beispiel: In ihrem Umfeld sieht sie viele Leute, die Sozialhilfe beziehen, während sie in den Boulevardmedien liest, dass „Sozialschmarotzer“ der Grund sind, warum alle anderen zu wenig Geld haben. Das Argument kommt dann bei ihr besser an, weil sie das in ihrem Umfeld bestätigt sieht.
Andererseits zahlt sie eine sehr hohe Miete, doch sie kommt nicht auf die Idee, das dem Vermieter anzukreiden. Dafür ist kein Bewusstsein vorhanden – dass es eigentlich der Vermieter ist, der einen viel zu hohen Preis verlangt. Ich glaube, das ist ein Versagen der linken Parteien, diese Themen das ganze Jahr über groß zu kommunizieren.
SELBSTHASS UND HASS GEGEN ANDERE
Kontrast: In einer Szene erklärt der arbeitslose Protagonist, er wähle weiterhin die FPÖ – selbst wenn sich seine Lebenssituation dadurch verschlechtert. Er nehme es in Kauf, selber schlechter dran zu sein, wenn es dafür „den Ausländern“ auch schlechter geht. Wie kann es passieren, dass Menschen so gegen ihre eigenen Interessen wählen?
Gladik: Im Film kommt raus, dass dieser Protagonist selbst viel Abwertung und Hass in seinem Leben erlebt hat. Meine Vermutung ist:
Jemand, der selbst viel Hass und Gewalt erlebt hat, ist eher dazu bereit, das gegen andere zu wiederholen.
Menschen, die in glücklichen Verhältnissen aufgewachsen sind, Wertschätzung bekommen haben und in einem Job arbeiten, der sie befriedigt, können sich vielleicht weniger darüber freuen, wenn andere weniger kriegen.

Kontrast: In Ihrem Film gehen sie bewusst in Dialog mit ihren ProtagonistInnen und scheinen damit bei ihrem Gegenüber auch Denkprozesse anzustoßen. Kann man Menschen dazu bringen, ihre Wahlmotive zu überdenken?
Gladik: In einem Gespräch bringt man sich immer gegenseitig zum Nachdenken. Ich habe selbst auch wahnsinnig viel von diesen Gesprächen gelernt, denke jetzt viel differenzierter.
Stress, Leistungsdruck, Konkurrenz am Arbeitsplatz, zu wenig Zeit für die Familie und soziale Kontakte, schnelle technologische Entwicklung, bei der man ständig mithalten muss – viele Menschen haben dieselben Grundprobleme.
Das gibt es sowohl für mich im Filmbereich als auch für Leute, die in einer Fabrik arbeiten. Das ist, worunter wir alle sehr leiden. Schließlich gibt es auch viel zu wenig Zeit, um sich politisch auseinanderzusetzen.
ALTERNATIVE AUSSICHTEN
Kontrast: Was müsste die Linke tun, um da eine Alternative zu sein?
Gladik: Hannah Arendt hat einmal gesagt, Menschen müssten mehr Zeit für politisches Engagement haben. Ich glaube, sie hat es in Drittel aufgeteilt: ein Drittel Arbeit, ein Drittel Familie und ein Drittel Zeit für politisches Engagement, für Demokratie – um sich zu überlegen, wie man eigentlich leben will, wie man die Wirtschaft gestalten möchte, etc. Möglicherweise wäre der erste Schritt eine Art Generalstreik, damit wir erst einmal mehr Kopf und Zeit für Demokratie haben.
Kontrast: In den Ibiza-Videos konnte man eine ganz andere Seite von HC Strache sehen, in der er offen dazu steht, die Interessen von großen Konzernen zu vertreten. Sehen FPÖ-WählerInnen Strache nach dem Ibiza-Gate nun anders?
Gladik: Ich habe nach Ibiza wieder ein bisschen herumgefragt und Unterschiedliches gehört, wie: „Die anderen Parteien sind ja auch korrupt, nur lassen sie sich nicht dabei filmen!“, „Man hat dem Strache eine Falle gestellt und das ist gemein!“, oder „Es gibt ja noch den Hofer und der wird es schon richten.“
Manche haben gesagt, sie können die FPÖ jetzt nicht mehr wählen.
Trotzdem denke ich, dass der Skandal der FPÖ wahrscheinlich nicht sehr geschadet hat. Das sieht man auch auf ihrer Facebook Seite, wo sie einen Diskurs des Zusammenhalts und der Opferrolle pflegen. Mit dieser Opferrolle können sich viele Leute identifizieren. Das Konzept der FPÖ ist eine Politik der Emotionen, und das funktioniert wahnsinnig gut.

































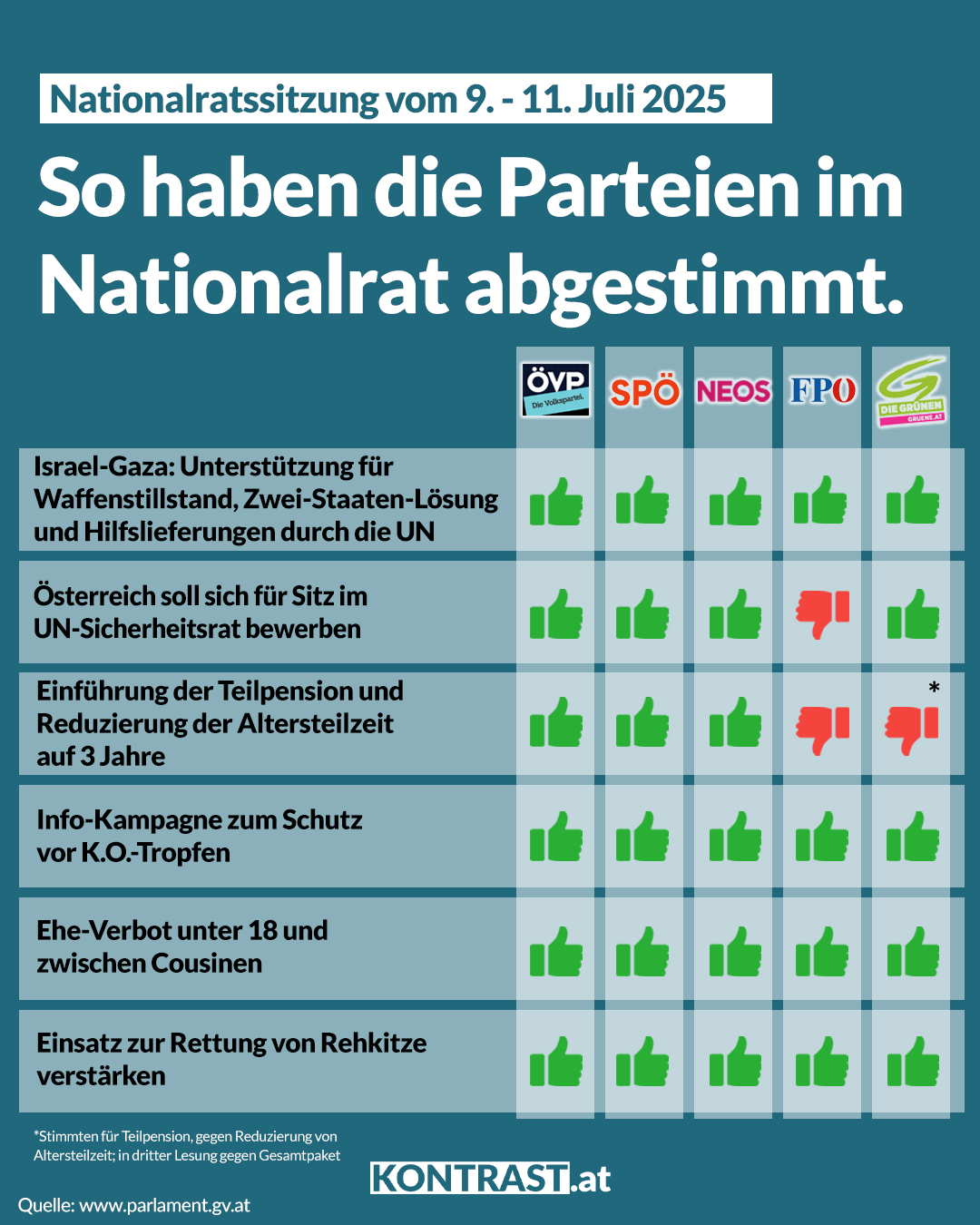



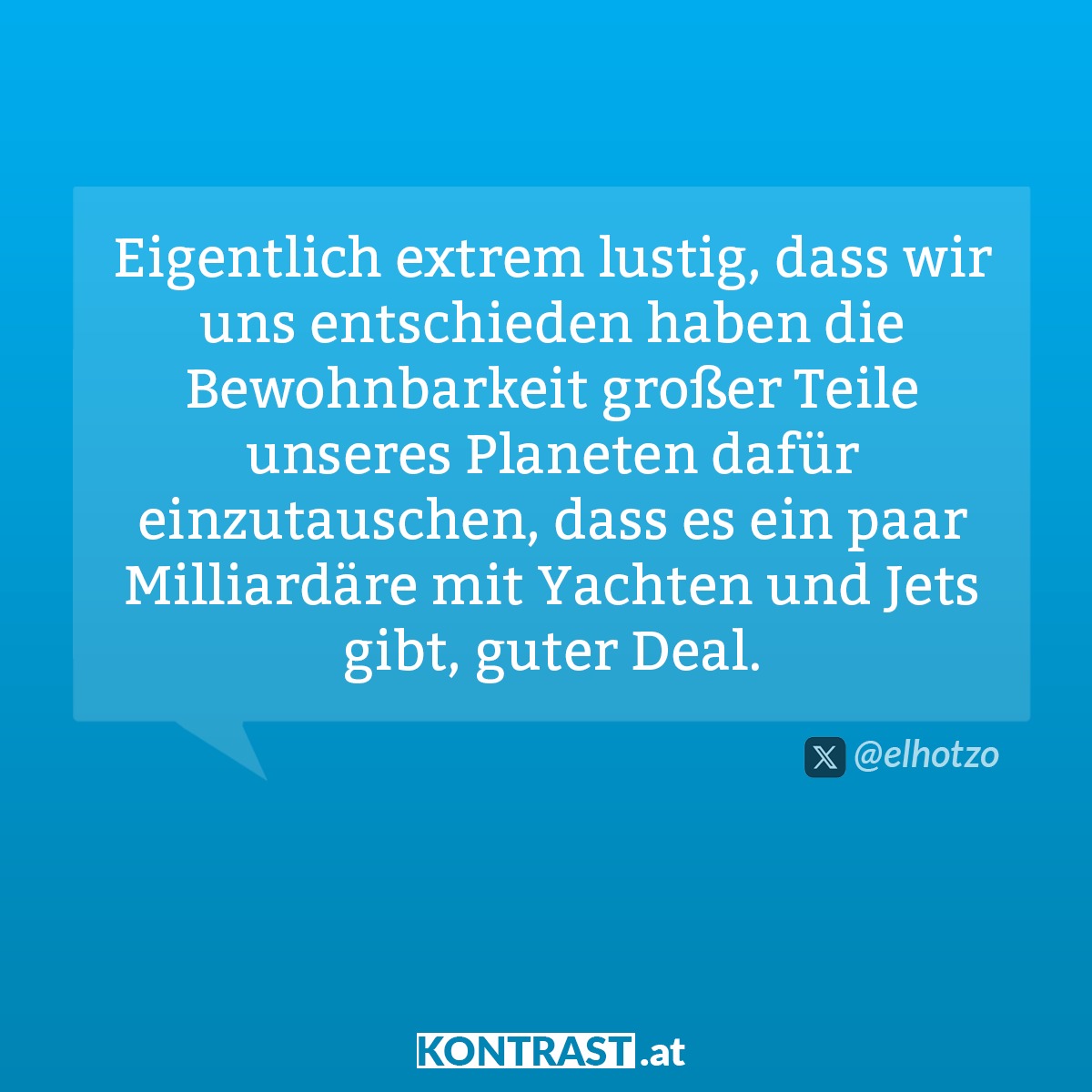
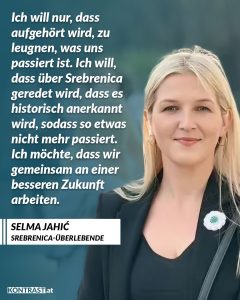




Es gibt weder kleine Leute, noch gibt es eine Sozialhilfe.
Die Illusion ist wohl eher die einer Mittelstandsgesellschaft in der die Einkommen normalverteilt wären. Dass das akzeptiert wird entspringt einem Symmetrieverfolger dem Menschen anhängig sind.
Die Industrielinie wurde selbst auf auf das Individuum ausgerollt. Da gilt mal die Logik. Jedes Jahr mehr Menge, jedes Jahr höherer Gewinn und das bei sinkendem Gewinn pro Mengeneinheit und das muss bei konstanter ‚Arbeitszeit‘ auf Dauer schiefgehen.
Vereinfacht gesagt, fällt einer (echten) Industrielinie der Preisindikator zu schnell, wenn sie auf einen Marktplatz liefert. Deswegen könnte die Linie die Reproduktion in ihr nicht mehr stemmen. Die Preisbildung am Marktplatz verhindert genau diese Kapitalungleichverteilungen. Jetzt bekommt die Industrielinie als erster die Münzen und gibt zuwenige weiter. Dadurch entsteht die Abwertungstendenz der Einkommen in Richtung Rohstoff. Die Linie muss im Gegenzug die komplexen Bereitstellungsprozesse dem Konsumenten am nächsten vereinen. Eine Industriegesellschaft kann nie eine mittelständische Wirtschaft sein. Setzt die Linie den Preisindikator zu hoch an, dann wird das auf Dauer als das vortäuschen von Scheinkomplexität im Rahmen der Bewirtschaftung angesehen (aka. zu teuer). Wenn dann alle Unternehmen und Betriebe mehr oder minder ‚gleich‘ aka. standardisiert sind, … dann ist man im deutschen Industriemodell.
Konzerne sind eine weiter Steigerungsstufe, da Unternehmen keine rekursives Konzept ist. Eigen bildeten Konzerne zu Beginn eher Beschaffungsmärkte aus, haben sich aber im Rahmen der Matrixorganisation in eigene Märkte verwandelt. Die Industrielinie in der Konsumentengesellschaft verbindet mit Märten, dass das Geld die Linie nie verlässt.
Der Markt(platz) hält das Geld welches als Einkommen zu Beginn der Handelsperiode, früher der Morgen und endete am Abend (dann hat man die Leute die Äpfel nachgeschmissen ums billige Geld damit man sich nicht mit nach Hause nehmen musste). Die in den Geldbeuteln klimpernden (her)einkommenden Münzen sind das Einkommen.
Im Fall des Lohns ist die Periode heute ein Monat (früher war sie eine Woche). Der Mensch läuft zu einem Marktstanderl einmal im Monat ein.
In der Konsumgesellschaft läuft die Sache anders. Der Konsument wird heute eher (stark anbieterseitig getrieben) vor das Auslieferunglager des Güterbereitsteller gezerrt und frägt den Verbrauher nurmehr, ‚Willst du mein Gut.
Wenn ja, dann wieviel Menge‘. Ansonsten legt der Güterbereitsteller den Preisindikator fest (politisch gewollte, insbesondere von der linken Brut) und muss im Gegenzug den Kredit halten. Derjene der den Preisindikator festsetzt muss in einem Kreditgeldsystem einen Kredit halten. Die lustigen Zahlen die jeden aufs Konto gutgeschrieben werden haben mit Geld nichts zu tun. Das sind Punkt die 1:1 bei Bedarf in EURO konvertiert werden können. Die repräsentieren allein den Informationsaspekt im Rahmen der Bildung des Preisindikator, den aber der Bereitsteller exklusiv festlegt (in Europa, also im Sozialismus).
Der Konsument ist ein kastrierter Marktplatz mit einem Marktstanderl hinter dem der Mensch als Güterempfänger in der Rolle der Verbrauchers verweilt. Der Konsumententrottel glaubt, das Währung Geld ist und er Werkzeuge bekommt. Der unselbstständige Erwerbstätige ist mal zum Dasein unter dem Motto ‚Friss Hund oder stirb‘ verdammt. Konsument des Verbrauchers. Für einen selbständig erwerbstätigen oder Unternehmer ist ein so ein Konsument der letzte Dreck bezüglich der Ausgestaltung im Sinne des Tausches.
In einem Unternehmen nennt man in einer zumeist Industrielinie den selben Sachverhalt ‚Dependency‘ sprich eine Abhängigkeit vom Güterbereitsteller.
Die depperten Politiker & Friends in unserem Land nennen das alles seit ca. gut 40 Jahren noch immer die sog. Wirtschaft.
Der Vorteil heute ist, dass es keine zusätzliche Begrenzung der Geldmenge an sich gibt. Das Geld steht bereit sobald die Rechnung geschrieben ist, was noch nicht heißt, dass die damit verbundene Forderung auch beglichen werden kann.
Wäre der Verbraucher auf einem Marktplatz, dann hätte er nur dann Münzen in der Tasche, wenn er bestellt hat und die Lieferung noch nicht erfolgt. Der Verbraucher erhält nur ‚Münzen‘ für den Zeitpunkt vom Tausch gemeinsam mit der Gütermenge übergeben. Der Betrag wird vom Kreditrahmen (Geldmenge im Konsumenten) abgezogen.
–
Hört sich verführerisch an, wenn sich jeder die Taschen vollräumen kann. Aber das kann man nur, wenn man einen Arbeitstag im Rahmen der Selbständigkeit nach den 8 Stunden unselbstständiger Erwerbstätigkeit anhängt. Dem Selbstständigen geht es auch nicht anders, der muss 8 Stunden Unternehmertum anhängen.
Es ist einfacher ein zusätzliches Einkommen aufzumachen. Sobald mal ein Angebot entstanden ist welches angenommen wird, ist der Zuverdienst in dem Rahmen leichter zu lukrieren ist als den selben Betrag im des Einkommens des unselbstständig Erwerbstätigen (Lohn). Der klassische Industrielohn (Entgelt des klassischen Arbeiters) wurde obsolet, war aber ausverhandelt.
Deswegen wurde dieser von der SPD übernommen und die österr. Politik zu Wirtschaftspolitik in der Regel unfähig hat einfach die Deutschen nachgeäfft. Verkauf wurde der Vorgang unter dem Deckmantel, ‚Jeder kann reich werden, wenn er nur hart genug arbeitet‘. Damit ist aber nicht gemeint während des Verweilens auf einem Betriebsgelände unnotwendige Aktivitäten im Rahmen der Beschäftigung zumeist noch engagiert abzuarbeiten. Als Arbeit bezeichnet werden in der Regel die engeren Aktivitäten bei der Bereitstellung eines Produkts.
Der Akademiker war allein im Rahmen der Objektivierung bei der Festsetzung der Einkommenshöhe des refurbishten klassischen Industrielohns (aka. zumeist Gehalt) relevant, da ja keiner mehr arbeitet sondern allein auf einem Betriebsgelände verweilt (wie einst die Angestellten). Warum soll Akademiker ein höheres Einkommen bekommen oder einen Job? Der leitende Angestellte ist auch noch so totes Relikt aus der Zeit. Hirnvrebrannter Scheiß und sonst gar nichts.
Der Übergang zum letztendlich Controlling passierte auf der Unkalkulierbarkeit der Kosten der Güterbereitstellung bei hohem Automatisierungsgrad. Die G’studierten im Büro haben allein den einstigen Arbeitern weniger Lohn zugestanden, da es keine Arbeiter mehr gibt im Umfeld der unselbstständig Erwerbstätigen. Hängt bei der nächsten Revolution nicht zuerst die Politiker, sondern die Wirtschaftsakadmiker.
Im Kontext des Betriebs existiert die Rolle des Arbeiters noch. Die Definition der Rolle ist Teil des Unternehmens. Dadurch dass die Unternehmensrechnung nicht mehr das Ergebnis der Handlungen im Betrieb darstellt (bottom up, hinauf schauend), sondern zumeist Vorgaben auf der Unternehmensebene begrenzt über Budgets im Betrieb beinahe normativ reflektiert sind (top down, von oben herab schauend), entsteht der Eindruck den Arbeiter gäbe es noch. Willkommen bei blond und blauäugig.
Die Wahl zwischen bottom up und top down zu haben heißt nur die Perspektive zu wechseln, aber nicht den Sachverhalt an sich.
–
Dem entkommt man erst durch Selbstständigkeit in der sog. Freizeit (das ist Arbeit) und sämtliche Aktivitäten die direkt mit dem Handeln von Assets in Verbindung stehen bei der man selbst die eigene Ware handelt (aka. Spekulation). Die Spekulationsgewinne an den Aktienbörsen sind der Ersatz für die einstige Spareinlage im Haushaltseinkommen (Idee der 1980er resp. der 1990er).
–
In dem Punkt hat die FPÖ ein Defizit. Unter Haider wurde die FPÖ eine Partei derjenen denen der Fleiß im Rahmen des Wirkens im Rahmen von Aktivitäten auf einem Betriebsgelände nichts mehr gebracht hat.
–
Der Kühnert hat mal gesagt, „Der ominöse Staat, für den Ihr bislang alle gearbeitet habt, ist übrigens kein gemeiner Schutzgelderpresser. Sondern das sind wir alle“.
Der sog. klein(gehalten)e Mann kann beruhigt sagen, ‚Ich stimme zu. Alle anderen sind gemeine Schutzgelderpresser‘, zumindest jene die ein höheres Einkommen haben. Damit sind jene die deren Höhen orchestrieren die Anstifter. Eine Gruppe davon sitzt verteilt auf Parteien aber am Ende doch geschlossen im Parlament.