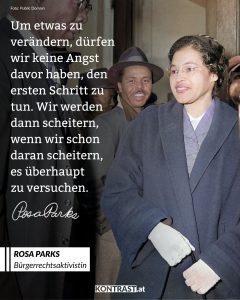Hier können Sie die AI-generierte Audioversion dieses Artikels anhören.
Was der „Fall Anna“ in Österreich ist, war der „La Manada“-Fall in Spanien 2016. Ein Ereignis massiver sexueller Gewalt hat damals Proteste im Land ausgelöst. Forderungen nach einem schärferen Sexualstrafrecht wurden laut. 2022 hat Spanien ein solches verabschiedet. Mit dem „Ley del solo sí es sí“ (Nur Ja heißt Ja) hat man erstmals ein Konsensprinzip im Sexualstrafrecht verankert. Seitdem müssen Frauen und Mädchen nicht mehr beweisen, dass sie sich gewehrt haben – sondern die potenziellen Täter beweisen, dass es Zustimmung gab.
Am 7. Juli 2016 attackierten fünf Männer eine 18-jährige Frau in Pamplona, Spanien. Man hat sie vergewaltigt, die Taten mit Handys gefilmt, die Videos in einem WhatsApp-Chat herumgeschickt, der „La Manada“ („Das Wolfsrudel“) hieß. Die Frau zeigte die Taten an. Vor Gericht erhielten die Männer zunächst lediglich eine Strafe wegen sexuellen Missbrauchs, nicht aber wegen Vergewaltigung. Denn nach damaligem Recht waren Gewalt oder Einschüchterung erforderlich, um den Tatbestand zu erfüllen.
Legal ist Sex nur, wenn alle Beteiligten zugestimmt haben
Die öffentliche Empörung war enorm, feministische Proteste zogen durch alle Landesteile. Es folgte eine gesellschaftliche Debatte über sexuelle Selbstbestimmung. Die damalige sozialdemokratische Justizministerin Pilar Llop (PSOE) forderte 2021: „Schweigen darf nicht länger als Ja gelten. Wir können die Opfer nicht weiter allein lassen.“
Tatsächlich verschärfte Spanien das Sexualstrafrecht. Die Reform trat im August 2022 in Kraft und hat das Strafrecht in diesem Bereich völlig neu ausgerichtet. Der zentrale Punkt: Eine sexuelle Handlung ist nur dann legal, wenn alle Beteiligten ausdrücklich zugestimmt haben.
Fehlt diese Zustimmung – etwa weil jemand unter Schock steht, Angst hat oder in einer Abhängigkeitsbeziehung lebt – gilt die Handlung als strafbar. Damit folgt Spanien dem sogenannten Einwilligungsmodell (Konsensprinzip). Entscheidend ist nicht mehr, ob sich das Opfer gewehrt hat, sondern ob es aktive Zustimmung gegeben hat.
Verschärftes Sexualstrafrecht heißt auch, dass Mädchen und Frauen vor Gericht nicht noch einmal erniedrigt werden
Zudem wurden die unterschiedlichen Straftatbestände – wie sexuelle Belästigung, Missbrauch oder Vergewaltigung – zu einem einheitlichen Delikt der „sexuellen Gewalt“ zusammengefasst. Das Ziel: Klarheit schaffen, Betroffene besser schützen, Täter konsequenter verfolgen. Man hat weiters spezielle Maßnahmen zur Opferbetreuung eingeführt, darunter psychosoziale Unterstützung, verbesserter Opferschutz im Verfahren und verpflichtende Schulungen für Polizei und Justiz.
Die Reform wurde von vielen Seiten begrüßt: Frauenrechtsorganisationen lobten die Verankerung der sexuellen Selbstbestimmung, Menschenrechtsinstitutionen sahen Spanien als europäische Vorreiterin. Ablehnung gab es aus der konservativen Opposition, die das Ganze als „ideologisch motivierten Schnellschuss“ abtat.
Nach Inkrafttreten kam es allerdings zu einem unerwarteten Nebeneffekt: Da das Gesetz rückwirkend galt und neue Strafrahmen definierte, wurden in einigen Fällen bereits verurteilte Täter in der Folge freigelassen oder erhielten Strafminderungen. Dies löste erneut politische Kontroversen aus und veranlasste die Regierung, 2023 Nachschärfungen zu beschließen.
Gisèle Pelicot hat in Frankreich mit ihren Aussagen und ihrer Stärke Gesetzesänderung vorangetrieben
Die Französin Gisèle Pelicot hat 2024 gegen ihren Ex-Mann Dominique Pelicot prozessiert. Er hat seine Frau über Jahre hinweg betäubt und sie in etwa 200 Fällen selbst vergewaltigt und von anderen Männern vergewaltigen lassen. Er wurde im Dezember 2024 zu 20 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Es war Gisèle Pelicots ausdrücklicher Wunsch, dass der Prozess öffentlich geführt wird und begründete es unter anderem mit dem Satz: „Die Scham muss die Seite wechseln!“
Auch ihr Fall hat monatelange Proteste ausgelöst, in denen man ein schärferes Sexualstrafrecht gefordert hat. Im Juni 2025 hat der Senat ein neues Gesetz hierzu verabschiedet, das ebenfalls „Nur Ja heißt Ja – ein Schweigen reicht nicht“ festschreibt.
Frankreich in guter Gesellschaft: 14 Länder in Europa setzen auf Konsens
Frankreich reiht sich mit seiner Reform des Sexualstrafrechts in die wachsende Gruppe an Ländern ein, die auf das Konsensprinzip setzen. 18 Staaten in Europa rücken Zustimmung ins Zentrum ihrer Gesetze: Belgien, Dänemark (seit 2020), Finnland (seit 2023), Frankreich (seit 2025), Griechenland (seit 2019), Irland*, Island (seit 2018), Kroatien (seit 2021), Luxemburg (seit 2020)*, Malta, Montenegro (seit 2021)*, Niederlande (seit 2024), Norwegen (seit 2025), Schweden (seit 2018), Slowenien, Spanien, das Vereinigte Königreich* und Zypern.
*Ergänzungen
England und Wales haben – im Vergleich zu Spanien z.B. – ein eher schwammiges Konsensprinzip: Das Gesetz definiert zwar Konsens als Voraussetzung, aber es verlangt keine ausdrückliche Zustimmung und es geht hierbei stärker um die Wahrnehmung des potenziellen Täters. Schottland hat ein eigenes Sexualstrafrecht, das ebenfalls Zustimmung definiert, aber auch nicht explizit das „Nur Ja heißt Ja“-Prinzip verankert.
Irland hat eine Regelung vergleichbar mit England oder Wales.
Luxemburg hat zwar eine erweiterte Definition von Vergewaltigung, die auch sexuelle Handlungen ohne klare Gewalt erfassen kann – aber kein verankertes „Nur Ja heißt Ja“-Prinzip.
In Estland hat die Justizministerin im August 2025 einen Gesetzesvorschlag mit Konsensprinzip vorgelegt, die Regierung hat diesen bereits gebilligt – doch er muss erst abgestimmt werden und in Kraft treten.
Portugal hat kein direktes Konsensprinzip wie Spanien oder Frankreich beschlossen. 2019 hat allerdings die portugiesische Regierung die Resolution 139/2019 verabschiedet, die Einwilligung zum Kernprinzip sexueller Handlungen macht.
Auch in Österreich soll das „Nur Ja heißt Ja“-Prinzip kommen
In Österreich emotionalisiert aktuell die vom Boulevard als „Fall Anna“ bezeichneten Freisprüche. Zehn Jugendliche sollen 2023 im Alter von 14 bis 18 die damals Zwölfjährige in ihrer sexuellen Selbstbestimmung verletzt haben. Zweien davon wurde zusätzlich sexuelle Nötigung vorgeworfen. Das Gericht begründete die (nichts rechtkräftigen) Freisprüche damit, dass nicht bewiesen werden konnte, dass die Jugendlichen gegenüber dem Mädchen Druck, Drohung oder Gewalt ausgeübt haben.
SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer kündigte daraufhin an, das Sexualstrafrecht verschärfen zu wollen. „Eine Maßnahme, die wir umsetzen wollen, ist die Einführung des Zustimmungsprinzips ‚Nur Ja heißt Ja‘. Damit müsste das Gericht künftig überprüfen, ob eine Zustimmung vorlag, und nicht mehr, ob sich die Frau gewehrt hat oder zu erkennen gegeben hat, dass der Sexualakt gegen ihren Willen vollzogen wird“, kündigte Sporrer an. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (ebenfalls SPÖ) fordert schon seit Juni 2025 eine derartige Verschärfung.