Hier können Sie die AI-generierte Audioversion dieses Artikels anhören.
Nach dem Urteil im „Fall Anna“ debattiert man in Österreich wieder über das Sexualstrafrecht. Justizministerin Anna Sporrer will im Gesetz das Prinzip „Nur Ja heißt Ja“ festschreiben. Sie will klarstellen, dass sexuelle Handlungen nur bei ausdrücklicher Zustimmung erlaubt sind. Im Gespräch mit Kontrast erklärt Sporrer, wie das neue Gesetz das Vertrauen in die Justiz stärken soll, warum Gewaltambulanzen entscheidend für die Beweisführung sind und welche Maßnahmen sie gegen Femizide plant.
Nur Ja heißt Ja: „Das Verständlichste auf der Welt“
Kontrast: In Österreich wird das Urteil im „Fall Anna“ hitzig diskutiert, bei dem zehn Jugendliche im Prozess wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung einer Minderjährigen freigesprochen wurden. Vor dem Hintergrund dieser Debatte wollen Sie das Sexualstrafrecht ändern. Was soll sich mit dem „Nur Ja heißt Ja“-Prinzip ändern?
Anna Sporrer: Dieses Vorhaben verfolgen wir schon länger. Die Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und ich haben uns schon im Frühjahr darüber ausgetauscht. Es gibt ja auch Modelle in anderen Ländern. Norwegen hat das heuer eingeführt, Schweden als erstes Land innerhalb der EU schon 2018, und auch in Österreich gab es bereits 2015 eine solche Diskussion rund um die Einführung des Straftatbestandes „Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung“. Es geht schlichtweg um die Frage, ob ein Sexualakt strafbar ist, wenn es keine Zustimmung gab.
Derzeit ist die Regelung so, dass eine sexuelle Handlung nicht gegen den Willen des Opfers oder der betroffenen Person durchgeführt werden darf. Künftig soll man sich der Zustimmung vergewissern müssen.
Im Endeffekt wollen wir das Selbstverständlichste auf der Welt auch im Gesetz widergespiegelt haben, nämlich dass sexuelle Handlungen einvernehmlich stattfinden sollen.
Kontrast: Dennoch bleibt der Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ bestehen. Rechnen Sie damit, dass es zu mehr Verurteilungen kommt?
Anna Sporrer: Die Staatsanwaltschaft ist die Anklägerin, die im Interesse der staatlichen Autorität das Strafverfahren leitet und die Tat beweisen muss. Das Gericht führt das Beweisverfahren durch und hört sich beide Seiten an. Man wird im Sexualstrafrecht immer ein Beweisproblem haben. Es ist ja so, dass gerade bei Sexualdelikten normalerweise niemand sonst anwesend war. Da steht dann Aussage gegen Aussage. Generell können die Gerichte das sehr gut beurteilen. Die Richter und Richterinnen werden ja dafür ausgebildet, dass sie die Wahrheit erforschen. Aber oftmals bleibt der Beweis unklar und dann ist natürlich freizusprechen.
In Gewaltambulanzen geht es um Heilung und um Beweissicherung
Kontrast: Es ist auch ein Problem, dass Frauen das Vertrauen in Behörden verloren haben, weil Anzeigen bei einer Vergewaltigung häufig eingestellt werden oder es gar nicht erst zu einem Verfahren kommt. Was müsste man hier tun bzw. was würde sich mit dem neuen Gesetz ändern?
Anna Sporrer: Ich denke schon, dass es das Vertrauen von betroffenen Frauen in den Rechtsstaat und die Justiz stärken kann. Alleine die Debatte, die wir jetzt seit einigen Wochen intensiver führen, hat gezeigt, dass es ein großes gesellschaftliches Interesse gibt, dass wir im Gesetz abbilden, was sich die Bevölkerung erwartet und wünscht. Auch weitere Maßnahmen, die wir in meiner Amtszeit getroffen haben, sollen das Vertrauen von Gewaltbetroffenen in die Justiz und in die staatlichen Strukturen stärken.
Hier setzen zum Beispiel auch die Gewaltambulanzen an, die wir weiter ausrollen wollen. Das sind nicht normale Ambulanzen wie eine Unfallambulanz, wo man hingeht, wenn man eine Verletzung hat. Es werden die Beweise gesichert und die Spuren von Gewalt erhoben – und zwar gerichtsfest. Das bedeutet, dass diese Befunde vor Gericht einen sicheren, objektiven Beweis darstellen. Damit kann es dann auch zu besseren Verurteilungsquoten kommen, weil das Gericht einen zusätzlichen Beweis zur Aussage des Opfers hat.
Familie, Arbeitsplatz, Spital: Nationaler Aktionsplan gegen Gewalt soll alle Bereiche abdecken
Kontrast: Allein dieses Jahr gab es in Österreich 13 Femizide (Morde von Männern an Frauen aufgrund ihres Geschlechts) und 25 Mordversuche an Frauen. Woran scheitert ein wirksamer Gewaltschutz? Was plant das Justizministerium hier?
Anna Sporrer: Wir haben ein sehr gutes Gewaltschutz-Netz in Österreich. Es gibt die Frauenhäuser, Notrufe, Gewaltschutz-Zentren, Gewaltambulanzen, Frauenberatungsstellen, auch die Polizei als wichtige Präventions- und Schutzeinrichtung in Österreich.
Dennoch ist es bedauerlicherweise so, dass viele Opfer von Gewalt nicht den Weg zu diesen Unterstützungsangeboten finden. Hier müssen wir auf jeden Fall besser werden.
Ein Teil können die Gewaltambulanzen sein. Andere Maßnahmen sind eine bessere Aufklärung der Bevölkerung. Man muss dazu sagen, dass es sich bei längeren Gewaltbeziehungen häufig um sehr komplexe Abhängigkeitsverhältnisse handelt. Oft werden Opfer von Gewalt von ihrer Familie und ihrem Freundeskreis isoliert und finden nicht aus der Beziehung heraus. Deswegen müssen wir alle wachsam sein und zum Gewaltschutz beitragen. Es ist ein strukturelles Problem. Wir müssen an vielen Hebeln ansetzen.
Was wir in der Bundesregierung tun, ist zum Beispiel den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt umsetzen, den federführend die Frauenministerin fertigstellt. Hier geht es um eine Vielfalt von Maßnahmen, angefangen von Awareness- und Informationskampagnen. Wir schauen uns aber auch an, wo es überall Gewalt und Übergriffe gibt. In der Familie, am Arbeitsplatz, in den Spitälern zum Beispiel – alle diese Bereiche werden miteinbezogen. Jedes Ministerium hat dann seine Aufgabe zu erfüllen und Maßnahmen zu ergreifen.

Sofortiges Waffenverbot bei Betretungsverbot
Kontrast: Ein Bereich ist ja auch das Waffengesetz, das kürzlich verschärft wurde, u.a. bei Gewalt im sozialen Nahraum. Was erwarten Sie sich von dieser Änderung?
Anna Sporrer: Es ist gelungen, dass wir das Waffengesetz verschärft haben. Jetzt bedürfen zum Beispiel alle Kategorien von Waffen einer Genehmigung in der einen oder anderen Art. Aus Frauenperspektive ist uns gelungen, dass ein sofortiges vorläufiges Waffenverbot auszusprechen ist, wenn eine einstweilige Verfügung erlassen oder ein Ermittlungsverfahren wegen Straftaten im sozialen Nahraum eingeleitet wurde. Das gilt somit bereits, wenn ein Strafverfahren eingeleitet wird – und nicht erst nach einer Verurteilung. Das ist ein großer Erfolg. Das wird viele Frauen in Österreich schützen, weil wir wissen, dass ein hoher Prozentsatz von Morden und Mordversuchen mit Schusswaffen verübt worden ist.
Unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft soll Vertrauen in die Justiz stärken
Kontrast: Kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema. Eines der wichtigsten Vorhaben der Regierung ist die unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft. Was ändert sich mit dieser Einrichtung denn konkret?
Anna Sporrer: Derzeit ist es so, dass die Staatsanwaltschaften – das sind die Anklagebehörden, die u.a. darüber entscheiden, ob ein Strafverfahren eingeleitet oder eingestellt wird – einer Weisungskette unterliegen. Das geht von der Staatsanwaltschaft zur Oberstaatsanwaltschaft und dann letztlich zur Justizministerin, zum Justizminister. Das ist die Spitze der Weisungskette. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern eine Fachsektion im Ministerium übt diese Fachaufsicht aus. Außerdem gibt es ein Beratungsorgan: den Weisungsrat bei der Generalprokuratur beim Obersten Gerichtshof. Dieser berät in sogenannten „clamorosen“ Fällen, wenn es überregionale mediale Aufmerksamkeit gibt oder besonders gewichtige Rechtsfragen zu lösen sind.
Um jeglichen Anschein einer politischen Einflussnahme zu vermeiden, folge ich immer der Meinung der Fachaufsicht bzw. des Weisungsrats. Jetzt kann hier aber ein Minister oder eine Ministerin sitzen, die oder der nicht so zurückhaltend ist. Um den politischen Einfluss oder auch nur den Anschein einer Einflussnahme zu vermeiden, wollen wir die Fachaufsicht über die Staatsanwaltschaften unabhängig von der Politik machen. Es ist ganz klar, dass mehr Unabhängigkeit der Anklagebehörde auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz verbessert. Das ist auch Standard in der EU.
Wäre Österreich Beitrittskandidat, dann müssten wir eine unabhängige Staatsanwaltschaft schon mitbringen, um überhaupt Mitglied der EU zu werden.
Eine feministische Ministerin: Johanna Dohnal als Vorbild
Kontrast: Noch eine Abschlussfrage: Sie verstehen sich als Feministin – was heißt das für Sie in Ihrer Regierungsarbeit?
Anna Sporrer: Ich bin eigentlich seit meiner Kindheit Feministin. Ich war zum Beispiel eine der ersten katholischen Ministrantinnen in Österreich. Da habe ich schon meine ersten Diskriminierungserfahrungen erlebt. Es war nicht für alle so selbstverständlich, dass ein Mädchen ministriert.
Ein großes Vorbild war für mich dann Johanna Dohnal. Als sie Staatssekretärin für Frauenfragen wurde, war ich 17 Jahre alt. Für mich war das total faszinierend, weil da endlich eine Person aufgetreten ist, die das Unbehagen in Worte gefasst hat, das mich als junge Frau in einer patriarchalen Gesellschaft stets begleitet hat. Eine Person, die gesagt hat, „wir sehen das und wir machen was dagegen – und wir haben auch die Power, wirklich etwas zu verändern“.
Ich habe mich auch schon immer für Rechtspolitik interessiert, habe im Berufsleben aber dann doch mehr die juristische Seite eingeschlagen. Ich war lange Beamtin, kurz Rechtsanwältin und jetzt wieder lange Richterin. Dabei habe ich immer versucht, die Perspektiven von Frauen und einen feministischen Blick auf meine jeweiligen Aufgaben einzubringen. Damit macht man sich nicht beliebt. Ich freue mich sehr, dass Andreas Babler mich als Justizministerin in die Bundesregierung geholt hat. Hier in diesem Haus kann man sehr viel bewirken. Ich habe ein großartiges Team und sehr viele kompetente Leute im Justizministerium, die mich bei dieser Arbeit unterstützen.
Eine Feministin als Ministerin ist offenkundig nicht abschreckend, sondern ganz im Gegenteil sogar motivierend. So erlebe ich das.
„Nur Ja heißt Ja“: Immer mehr Länder setzen auf Zustimmungsprinzip im Sexualstrafrecht

































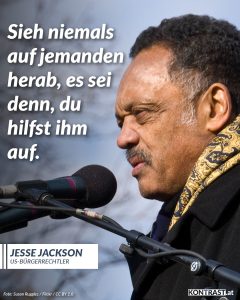

ein Justizministerin die nicht die Antifa nicht kennt ist entweder ein Dummchen oder sie lügt