In kaum einem anderen Land ist so viel Vermögen in so wenigen Händen konzentriert wie in Österreich. Das liegt nicht nur am Fehlen von Vermögens- und Erbschaftssteuern, sondern auch an einem Rechtssystem, das es Superreichen erlaubt, komplizierte Netzwerke aufzubauen, um ihr Vermögen vom Finanzamt zu verstecken. Stephan Pühringer und sein Team erforschen diese Netzwerke. Im Kontrast-Interview erklärt er, welche Auswirkungen die extreme Vermögenskonzentration auf unser Land hat und was wir dagegen tun können.
Kontrast: In Österreich ist Vermögen besonders ungleich verteilt. In kaum einem anderen Land hat eine kleine Gruppe Superreicher einen so hohen Anteil am gesamten Vermögen. Wieso ist das gerade in Österreich der Fall?
Stephan Pühringer: Österreich ist in der absoluten internationalen Spitze, was die Vermögenskonzentration betrifft. Bei uns ist ein besonders großer Anteil des Vermögens beim obersten Prozent angesiedelt und hier vor allem bei einer Hand voll besonders reicher Personen.
Interessant wird es, wenn man das mit der anderen großen Dimension der Verteilungsforschung vergleicht: dem Einkommen. Bei der Einkommensverteilung liegt Österreich nicht im Spitzenbereich. Einkommen ist im internationalen Vergleich bei uns relativ gleich verteilt.
Das hat damit zu tun, dass Österreich eine progressive Einkommenssteuer hat. Hier wird einiges von Primäreinkommen umverteilt. Beim Vermögen ist das ganz anders. Es wird quasi gar nicht besteuert. Bis auf die Grundsteuer, die auch minimal ist.
Kaum Steuer auf Vermögen in Österreich
Bei der Besteuerung von Vermögen ist Österreich wiederum an der internationalen Spitze. Es gibt kaum ein anderes Land, in dem so ein geringer Anteil des Steueraufkommens aus vermögensbezogenen Steuern eingehoben wird.
Ein weiterer Grund ist, dass in Österreich sehr viel Vermögen vererbt wird. Wir haben auch keine Erbschaftssteuer. Das verstärkt die ungleiche Verteilung von Vermögen zusätzlich.
Wir haben außerdem ein Rechtssystem geschaffen, das in vielen Bereichen die Konzentration von Vermögen durchaus begünstigt. Man denke an Privatstiftungen. Diese sind ein ganz zentrales Werkzeug, um große Vermögen über Generationen hinweg zu vererben. Privatstiftungen werden aber auch abseits des Erbens dafür eingesetzt, um Vermögen zu verstecken und für Steuerbehörden schwer zugänglich zu machen.
Dann spielt auch die Verschachtelung von Beteiligungsstrukturen von Unternehmen eine große Rolle. Das gibt es natürlich auch in anderen Ländern, aber in Österreich ist es besonders stark ausgeprägt.
So sind die Netzwerke der Superreichen aufgebaut
Kontrast: Die Netzwerke der Superreichen sind sehr komplex. Kannst du trotzdem versuchen zu erklären, wie so ein Netzwerk funktioniert?
Stephan Pühringer: Es gibt mittlerweile nicht wenige Studien, die sich auf quantitativen Ebenen mit der Schätzung von Vermögensungleichheit auseinandersetzen. Zusätzlich gibt es Einzelbiografien von Superreichen, die sehr oft so Jubelbiografien sind.
Das Dazwischen, der Netzwerkcharakter der Superreichen, war weitgehend unbekannt. Wie ist hier Vermögen strukturiert? Welche Beteiligungskonstrukte gibt es? Wie sind verschiedene Unternehmen über wirtschaftliche Eigentümer:innen miteinander verbunden? Das wollten wir erforschen. Gleichzeitig ging es uns nicht nur um einzelne Superreiche, sondern um das Netzwerk, das sie umgibt. Diese Netzwerke beleuchten wir mit unserer Studie.
Wir sind dann so vorgegangen, dass wir uns die Hochglanz-Magazine angeschaut haben also das Trend-Ranking der 100 reichsten Österreicher:innen. Ein Vermögensregister gibt es in Österreich nämlich nicht. Ausgehend von diesen Listen haben wir uns die zentralen Knotenpunkte in den Familien und den Unternehmen, die sie besitzen, angeschaut. Basierend darauf haben wir unsere Netzwerkanalyse aufgebaut.
Welche Unternehmen besitzen diese Superreichen? Welche Personen sitzen im Vorstand dieser Unternehmen und welche Unternehmen besitzen diese Personen wiederum? Das verstehen wir als Netzwerke der Superreichen.
Das haben wir für jede Person und jede Familie auf diesen Reichenlisten gemacht. Man sieht sehr schnell, dass die Netzwerke der Superreichen einerseits wachsen. Genauso sieht man einige Strukturmerkmale, die sich immer wieder wiederholen.
Rechtsordnung wird von Superreichen ausgenutzt
Kontrast: Sind diese Netzwerke und Beteiligungskonstrukte der Superreichen absichtlich so komplex, um Vermögen vom Finanzamt zu verbergen?
Das kann man sicher so sagen. Man muss aber natürlich festhalten, dass nicht jede Art von mehrfacher Unternehmensgründung mit Steuerhinterziehung verknüpft ist. So etwas kann natürlich betriebswirtschaftlich Sinn machen, etwa in größeren Unternehmen mit verschiedenen Geschäftssparten. In solchen Unternehmen gibt es oft mehrere GmbHs, um Geschäftsbereiche zu trennen.
Was wir aber in unserer Studie finden, ist derartig auf die Spitze getrieben und überdehnt den Rechtsrahmen völlig. Die absolute Spitze ist bei uns eine Person, die in 250 GmbHs Geschäftsführer ist.
Es ist klar, dass es hier nicht um ein betriebswirtschaftliches Interesse geht, sondern darum, Rechtsformen zu zweckentfremden. Nehmen wir die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in der die Haftung auf die Einlage beschränkt ist. So eine Rechtsform macht Sinn, wenn ich etwa ein Elektriker bin. Wenn jemand einen Stromschlag bekommt oder es zu einem Brand kommt, hafte ich nicht mit meinem gesamten persönlichen Vermögen, sondern der kleine Elektroinstallationsbetrieb haftet mit dem, was in dieser Firma liegt.
Wenn wir jetzt aber dieses beschränkte Haftungsrecht aufskalieren und plötzlich 250 Unternehmen einer Person gehören, dann geht es nicht mehr um die betriebswirtschaftliche Absicherung für Einzelpersonen zu, sondern es wird eine Rechtsform ausgenutzt.
Privatstiftungen fast ausschließlich von Reichsten der Reichen genutzt
Noch deutlicher wird das bei Privatstiftungen. Das Ergebnis unserer Studie ist, dass Privatstiftungen tatsächlich eine Rechtsform sind, die beinahe ausschließlich von den Reichsten der Reichen genutzt wird. Wir haben herausgefunden, dass sich 40 Prozent aller Privatstiftungen im unmittelbaren Umfeld der 60 reichsten Familien befinden.
Die Rechtsform der Privatstiftung wird von Superreichen also scheinbar auch benutzt, um ihr Vermögen vor Steuerbehörden zu verschleiern. Wir wissen aus dem COFAG-Untersuchungsausschuss, dass drei Viertel aller Privatstiftungen überhaupt noch nie kontrolliert worden sind.
Hinter diesen Vermögenskonstrukten steht eine ganze Industrie aus Vermögensverwalter:innen, Kanzleien, einzelnen Anwält:innen und Family-Offices im In- und Ausland. Die Industrie ist zugeschnitten auf diese kleine Gruppe der Superreichen, mit dem Ziel, Rechtsformen gezielt auszunutzen und Steuerbehörden den Zugang zum Vermögen und Einkommen der Superreichen zu erschweren.
Ob in diesen Konstrukten dann wirklich Steuerbetrug stattfindet, kann man nicht festmachen, aber die Strukturen würden dies zumindest stark begünstigen. Es macht jedenfalls keine gute Optik und der Verdacht liegt nicht ganz fern.
Superreiche beeinflussen Medien und Politik
Kontrast: In eurer Studie schreibt ihr, dass die Netzwerke der Superreichen einen enormen Einfluss auf Politik und Medien haben. Ist das eine Gefahr für unsere Demokratie?
Stephan Pühringer: Ja, absolut. Das ist auch der zentralere Punkt unserer Studie. Man könnte jetzt sagen, dass die Konzentration von ökonomischem Kapital und ökonomischer Macht an sich bereits problematisch ist, etwa für den Innovationsgrad einer Volkswirtschaft.
Das betrifft aber nur das ökonomische Feld. Bereits das ist nicht gut, aber es wird wesentlich schlimmer, wenn Überreiche direkte und indirekte Einflusskanäle auf Politik und Gesellschaft haben. Dann wird “Überreichtum” in eine politische Machtkonzentration übersetzt.
Am unmittelbarsten sehen wir das aktuell in den USA mit Elon Musk, Jeff Bezos und anderen Tech-Giganten, die durch Trump jetzt direkt Zugriff auf die Gesetzgebung haben. Man denke an Elon Musk und sein Department of Government Efficiency.
Es gibt aber auch indirekte politische Einflussnahme. In unserer Studie kommen oft politisch exponierte Personen vor, die Teil dieser Netzwerke der Superreichen sind. Für Superreiche macht es Sinn, solche Personen in ihr Unternehmen zu integrieren, etwa als Vorstände in einem ihrer Unternehmen oder Privatstiftungen.
Auch die mediale Vernetzung spielt in unserer Studie eine große Rolle. Mit der Familie Dichand haben wir eine Medienkonzentration in Österreich, die wahrscheinlich weltweit einzigartig ist. Wenn man sich anschaut, wem die Medien in Österreich gehören, dann sind das die katholische Kirche, die Raiffeisen Bank und ein paar wenige reiche Familien wie die Dichands.
Ökonomische Macht lässt sich in politische und mediale Macht übersetzen. Die hohe Konzentration an Vermögen in Österreich wirkt sich also auch auf Medien und Politik aus.
Superreiche vs. Finanzamt
Kontrast: Was kann man tun, um die Vermögenskonstrukte der Superreichen dem Finanzministerium besser zugänglich zu machen?
Stephan Pühringer: Fast alles, was wir mit unserer Studie fanden, sind legale Praktiken. Da drängt sich die Frage auf: Warum haben wir einen Rechtsrahmen, der diese extreme Konzentration von Vermögen ermöglicht?
Es ist nun einmal so, dass es kaum eine Person gibt, die sich im Privatschriftungsrecht sehr gut auskennt und nicht selbst in der Vermögensberatung arbeitet. Das heißt, wir haben gegenüber Superreichen einen unglaublichen Ressourcennachteil. Einer ganzen Industrie an Vermögensberater:innen steht ein Finanzamt gegenüber, das immer weniger Personal zur Verfügung hat. Das ist ein Riesenproblem.
Genauso könnten wir uns fragen, ob es Sinn macht, dass es unser Unternehmensrecht zulässt, dass eine Person Geschäftsführer von 250 Unternehmen ist. Das Problem ist ja eher, dass man all diese Dinge wenig diskutiert.

Genauso wird das Auseinanderklaffen zwischen den Superreichen und dem Rest der Bevölkerung kaum diskutiert. Das Vermögen von Superreichen ist ein Millionenfaches des österreichischen Durchschnitts. Diese Ungleichheit nimmt rasant zu. Covid oder die Finanzkrise hatten kaum negative Auswirkungen auf den Anstieg des Reichtums der Superreichen.
Und wieso werden diese Missstände kaum diskutiert? Weil der Großteil der österreichischen Medien in der Hand von ein paar reichen Familien und Institutionen ist.
Kontrast: Wenn vermutlich sehr viel Steuergeld bei den Superreichen und ihren Netzwerken zu holen ist, wäre es dann nicht sinnvoll, die personellen Ressourcen im Finanzministerium auszubauen?
Stephan Pühringer: Kurze Antwort: Ja! Es gibt internationale Studien darüber, dass es sich für den Staat wirtschaftlich lohnt, mehr Finanzbeamt:innen einzustellen. Diese Studien zeigen allesamt, dass eine:r zusätzliche:r Finanzbeamt:in das Vielfache seiner/ihrer Kosten einbringt.
Wir können uns Überreichtum nicht mehr leisten
Kontrast: Was passiert, wenn wir nichts gegen diese hohe Vermögenskonzentration unternehmen?
Wir machen aktuell ganz wenig gegen diese Vermögenskonzentration. Sie verschärft sich immer mehr. Wie schon erwähnt, diese ökonomische Macht lässt sich in mediale und politische Macht übersetzen. Das führt zu einer Krise der Demokratie. Genauso ist es ein ökologisches Problem. Superreiche stoßen viel mehr CO₂ aus als der Rest der Bevölkerung.
Das heißt, wir können uns “Überreichtum” ökologisch, sozial, politisch, aber auch ökonomisch nicht mehr leisten. Wir leben in einer Welt, die in vielen Bereichen Krisen erlebt. Wenn man hier jetzt nicht sehr schnell etwas dagegen macht, dann werden sich diese Tendenzen weiter verstärken.
Lange war die Idee verbreitet, dass der Reichtum der Superreichen auf den Rest der Gesellschaft hinunter sickern wird und zum Schluss alle besser dran sind. Etliche Studien zeigen aber, dass das nicht stimmt. Während die Reichsten der Reichen immer mehr Geld haben, steigt die absolute Armut an.
Vorbild Skandinavien
Kontrast: Gibt es Länder, die erfolgreich gegen den Einfluss von Superreichen auf Medien und Politik vorgehen?
Stephan Pühringer: Natürlich gibt es einige Länder, die Erbschafts- und Vermögenssteuern haben. Man denke etwa an Skandinavien. Die haben auch Vermögensregister, die die Erforschung von Reichtum und Vermögensungleichheit vereinfachen.
Für Österreich muss man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk positiv erwähnen. Wir haben in Österreich zwar eine enorme Medienkonzentration, aber die Öffentlich-Rechtlichen sorgen hier für einen gewissen Ausgleich.
Kontrast: Das Finanzministerium will Steuertricks etwa bei Luxusimmobilien, Töchterfirmen und Stiftungen beenden. Sind diese Schritte zur Eindämmung der Macht und des Vermögens der Superreichen hilfreich?
Stephan Pühringer: Diese Schritte sind begrüßenswert, genauso wie jede Diskussion darüber. Wir müssen uns aber darüber bewusst sein, dass unser aktuelles System eine Dynamik entwickelt hat, in der sich Ungleichheit massiv zuspitzt. Wir hegen mit diesen Schritten diese Entwicklung nur etwas ein. Selbst eine Vermögens- und Erbschaftssteuer, wie sie aktuell diskutiert wird, kann nur einen kleinen Beitrag zum Abbau der Ungleichheit bringen, gerade weil Vermögen ja meist in wesentlich höherem Ausmaß wachsen als die derzeit diskutierten Steuersätze. Über eine Erbschaftssteuer von 100%, die ja tatsächlich hier was ändern würde, spricht man ja nicht. Grundsätzlich ist es aber wichtig, dass die Steuer auf Privatstiftungen erhöht wird und Steuerschlupflöcher geschlossen werden, auch wenn es nur kleine Schritte sind und wir eigentlich große Sprünge brauchen.
„Gigantische Vermögen werden ohne jegliche Leistung oder Besteuerung vererbt“
Kontrast: Nehmen wir an, die österreichische Regierung lädt dich morgen für einen Vortag zu eurer Studie ein. Was würdest du ihnen vorschlagen, um die hohe Konzentration von Geld und Macht in der Hand einiger weniger zu reduzieren?
Stephan Pühringer: Ich glaube, es wäre wichtig, der Bundesregierung zu vermitteln, dass das Verhältnis zwischen Superreichen und dem Rest der Bevölkerung komplett aus dem Lot geraten ist. Das ist auch mit einem konservativen oder liberalen Weltbild nicht mehr vertretbar. Gigantische Vermögen werden ohne jegliche Leistung oder Besteuerung vererbt. Das ist ja auch Gift für den Leistungsgedanken, der gerade Liberalen und Konservativen so wichtig erscheint.
Eine wichtige praktische Empfehlung von mir wäre eine Reform der Privatstiftungen und die Einführung eines Vermögensregisters. Wie bereits angeführt, werden Privatstiftungen zweckentfremdet und dienen heute vor allem Superreichen bei der Verschleierung ihres Vermögens. Ein Vermögensregister würde uns helfen, die Ungleichheit in Österreich effektiv zu erforschen. Das wären zwei wichtige erste Schritte.
Grundsätzlich müssen wir eine Debatte darüber führen, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Sind wir damit einverstanden, dass ein paar Wenige einen enormen Reichtum anhäufen und somit enormen Einfluss auf Medien und Politik haben? Die USA sind hierfür ein mahnendes Beispiel. Oder wünschen wir uns eine gerechtere, demokratischere Gesellschaft? Wenn man über Gesellschaft, Wirtschaft und Politik der Zukunft nachdenkt, muss man die Verteilungsfrage angehen.
 Stephan Pühringer ist Sozioökonom und Leiter des Socio-Ecological Transformation Labs an der Johannes Kepler Universität Linz sowie stellvertretender Leiter des Instituts für die Gesamtanalyse der Wirtschaft. Seine Forschungsschwerpunkte sind soziale Ungleichheit mit Schwerpunkt auf Vermögensungleichheit und die sozial-ökologische Transformation. Für seine Forschung ist er mehrfach ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem Kurt-Rothschild-Preis der vom Karl-Renner-Institut verliehen wird.
Stephan Pühringer ist Sozioökonom und Leiter des Socio-Ecological Transformation Labs an der Johannes Kepler Universität Linz sowie stellvertretender Leiter des Instituts für die Gesamtanalyse der Wirtschaft. Seine Forschungsschwerpunkte sind soziale Ungleichheit mit Schwerpunkt auf Vermögensungleichheit und die sozial-ökologische Transformation. Für seine Forschung ist er mehrfach ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem Kurt-Rothschild-Preis der vom Karl-Renner-Institut verliehen wird.






















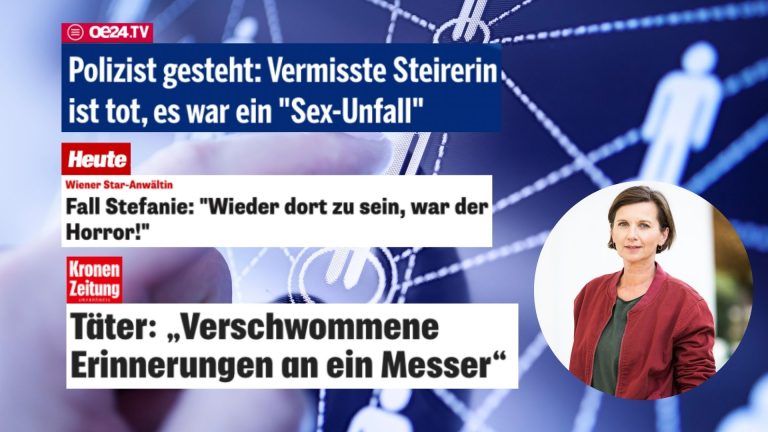










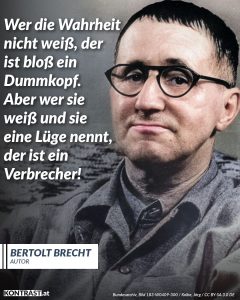

Wie wird das Thema in der Schweiz behandelt?
Dr.Heinrich,Salzburg
Liebe Frau Dr. Heinrich!
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Diesbezüglich darf ich Sie bitten, sich direkt an den Ökonomen Stephan Pühringer zu wenden. Unter diesem Link finden Sie seine Kontaktdaten: https://www.jku.at/institut-fuer-die-gesamtanalyse-der-wirtschaft/ueber-uns/team/stephan-puehringer/
Mit besten Grüßen
Claudia Binder-Helnwein
Backoffice
Redaktion Kontrast.at