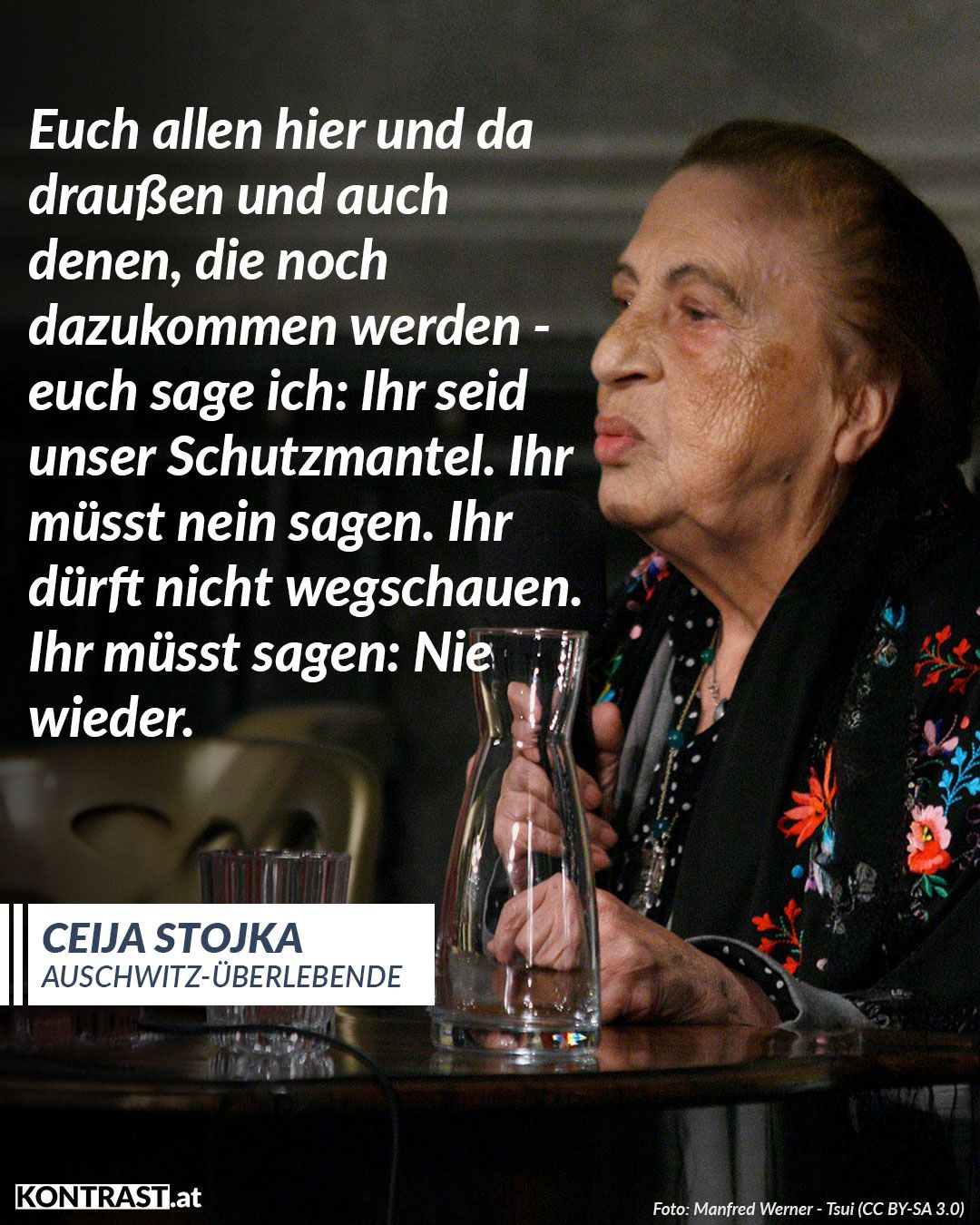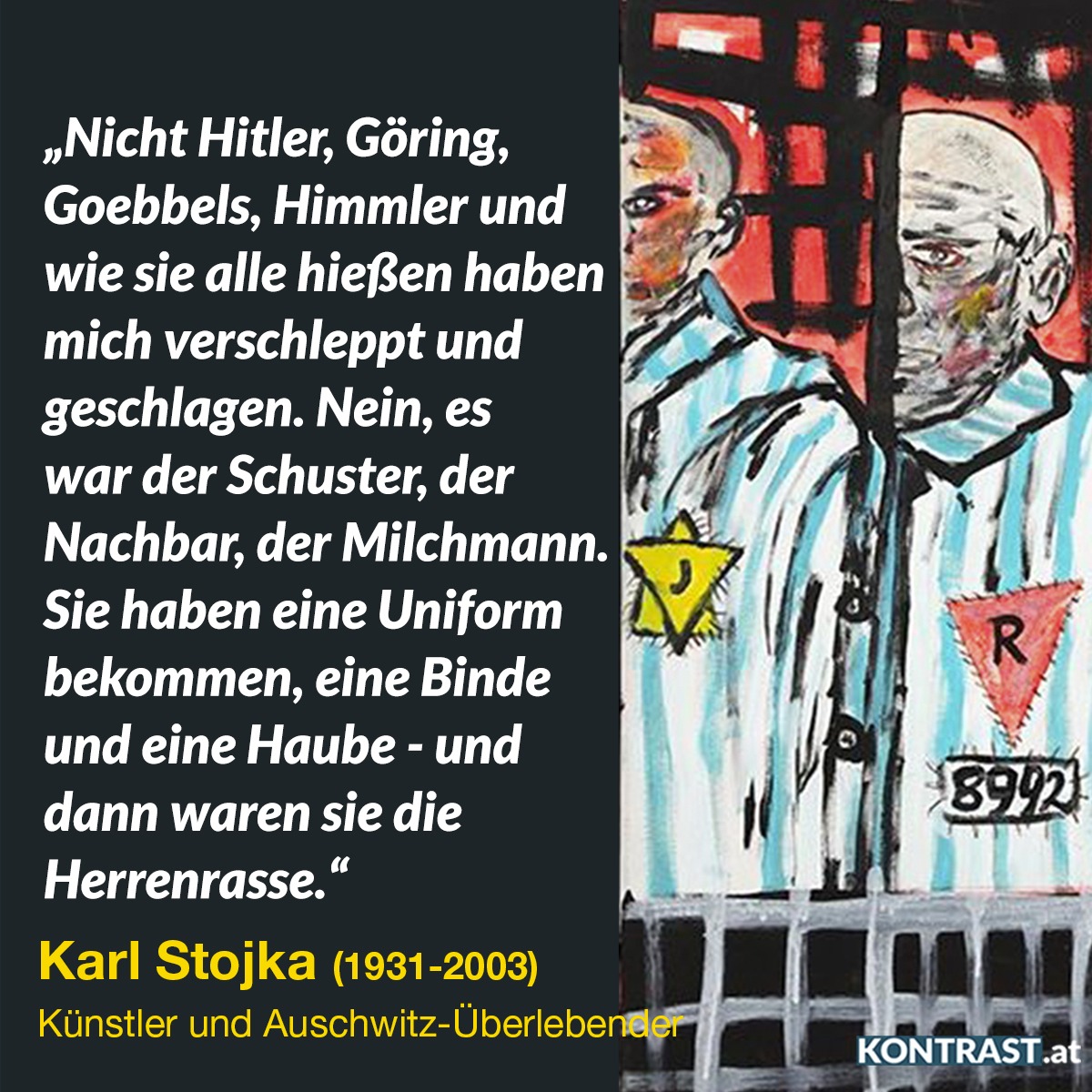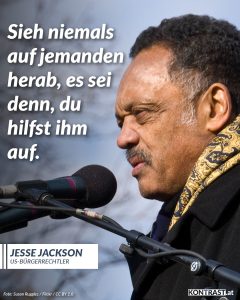Roma und Romnja sind mit rund 12 Millionen Menschen die größte ethnische Minderheit in Europa. Ihre Geschichte ist geprägt von Vielfalt, Widerstand – und Verfolgung. Schon im 18. Jahrhundert ordnete Kaiser Karl VI ihre „Ausrottung“ an; im Nationalsozialismus erreichte die Verfolgung mit dem systematischen Mord an rund einer halben Million Rom:nja ihren grausamen Höhepunkt. Seit 2015 gilt der 2. August als internationaler Gedenktag dieses Völkermordes. Heute kämpfen Rom:nja nicht nur für Anerkennung, sondern auch gegen tief verwurzelte Klischees und Diskriminierung. Dieser Artikel gibt einen Überblick über ihren kulturellen Einfluss in Musik, Literatur und Sprache, ihre Geschichte in Österreich und ihren Aktivismus in der Gegenwart.
Roma/Romnja: Die größte ethnische Minderheit Europas
Rom:nja als Sammelbegriff für vielfältige Untergruppen
Bei Roma und Romnja handelt es sich um eine ethnische Gruppe, die ursprünglich aus Indien stammt und im 9. Jahrhundert in den europäischen Raum gelangte. Heute stellen sie mit schätzungsweise 10 bis 12 Millionen Personen die größte ethnische Minderheit Europas dar. Rom:nja sind kulturell sehr vielfältig und uneinheitlich, weil die Minderheit aus einer Vielzahl von Untergruppen besteht. Die bestimmenden Merkmale dieser Untergruppen reichen vom gesprochenen Dialekt über die traditionell ausgeübten Berufe bis zum Ort, an dem sich die Angehörigen der jeweiligen Gruppe historisch angesiedelt haben.
Die Bezeichnung „Roma“ bzw. „Romnja“ (Einzahl: „Rom“ bzw. „Romni“) stellt einen Sammelbegriff für jegliche Untergruppen dar. Neben Lovara, Kalderasch, Romungre, Gitane, Manouches und vielen weiteren bilden auch Sinti:zze eine solche heterogene Untergruppe. Sie lebt seit dem 15. Jahrhundert in Mitteleuropa – vor allem im deutschsprachigen Raum. In Deutschland bilden sie die größte Gruppe der Rom:nja, weshalb dort vorzugsweise das Wortpaar „Sinti:zze und Rom:nja“ verwendet wird.
Aufgrund dieser kulturellen Vielfalt haben Rom:nja keine einheitliche Religion, Tracht oder Sprache – auch wenn ein großer Teil der europäischen Rom:nja traditionell Dialekte des Romanes spricht. Ebenso sind die Küche, Musik und Bräuche der verschiedenen Untergruppen sehr vielfältig und sowohl von der individuellen Geschichte als auch von der Kultur der Mehrheitsbevölkerung ihrer Lebensorte beeinflusst.
Das Z-Wort als Fremdbezeichnung und Beleidigung
„Zigeuner“ ist eine Fremdbezeichnung für Rom:nja. Das heißt, dass die Angehörigen der Minderheit diese Bezeichnung historisch nie für sich selbst verwendet haben. Sie wurde im Laufe der Geschichte vorwiegend abwertend gebraucht und diente häufig als Mittel zur Diskriminierung. Zu Zeiten des Nationalsozialismus stellte das Z-Wort eine Kategorie der verfolgten Personen dar. Es wird auch heute noch oft als beleidigendes Schimpfwort benutzt. In den 1970er Jahren war die Durchsetzung der Eigenbezeichnungen „Romn:nja“ und „Sinti:zze“ ein zentrales Anliegen der Bürgerrechtsbewegung der Minderheit.
Während das Wort „Roma“ auf Romanes „Mensch“ bedeutet, existiert das Z-Wort in der Sprache der Minderheit nicht. Es ist von negativen Vorurteilen und Diskriminierungsmechanismen geprägt. Aus diesen Gründen lehnen heute die meisten Rom:nja die Verwendung des Z-Wortes, wie auch anderer Fremdbezeichnungen wie „Gypsy“ oder „cigan“, durch Personen, die nicht zur Minderheit gehören, ab. Auch in diesem Artikel wird das Z-Wort nur zitiert, wenn es im historischen Kontext verwendet wurde. Die Redaktion distanziert sich von dieser beleidigenden Fremdbezeichnung.
Rom:nja-Kulturgut in Europa: Musik, Kunst und Handwerk
Im Laufe der Jahrhunderte prägten Rom:nja den Kulturschatz Europas in vielen verschiedenen Feldern. Die charakteristische Musik der Minderheit beeinflusste zahlreiche berühmte Komponist:innen und ist heute vielerorts Teil des nationalen Musikerbes: So haben Live-Auftritte von renommierten Roma-Kapellen in Restaurants und Cafés große Tradition in Ungarn und in der Slowakei und werden seit einigen Jahren als „nationaler Schatz“ von staatlichen Förderungen finanziert.
Der von den spanischen Gitan:as etablierte Flamenco ist ein Wahrzeichen Spaniens. Weiters sind traditionelle Roma-Lieder in vielen osteuropäischen Ländern und auch in der Türkei fester Bestandteil jeder großer Feierlichkeit und der vom legendären Gitarristen Django Reinhardt geprägte Jazz-Stil der französischen Manouche lockt bis heute zahlreiche Musikliebhaber:innen in die Jazz-Clubs von Paris.
Auch das Handwerk der Minderheit stellt ein europaweites Kulturgut dar. Viele Rom:nja waren bis ins 19. Jahrhundert gezwungen, umherzuziehen – ihnen wurden keine Häuser, Wohnungen oder Ackerlandgrundstücke vermietet oder verkauft und keine festen Arbeitsplätze gewährt. Aus diesem Grund übten viele Rom:nja traditionell handwerkliche Berufe aus und boten ihre Dienstleistungen und Waren als reisende Hausierende an. Zu den häufigsten Tätigkeiten gehörten die Gold- und Kunstschmiede, der Bau von Musikinstrumenten, das Sesselflechten und das Herstellen von Kesseln und Werkzeugen. Diese Handwerke wurden von Generation zu Generation weitergegeben und werden in vielen Familien bis heute gewahrt.

Rom:nja-Stimmen in der Literatur
In der Welt der Literatur wurden Rom:nja-Stimmen im Laufe des letzten Jahrhunderts ebenfalls immer lauter: Dichter:innen und Schriftsteller:innen wie Bronisława Wajs (auf Romanes „Papusza“ genannt) aus Polen, Philomena Franz aus Deutschland oder der Jovan Nikolić aus Serbien schrieben über ihre Lebens- und Überlebensgeschichten und trugen die Realität der Rom:nja in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Als eine der wohl bedeutendsten Rom:nja-Schriftsteller:innen und Künstler:innen Österreichs ist Ceija Stojka zu nennen. Sie überlebte als Kind die drei Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück und Bergen-Belsen und sprach als eine der ersten österreichischen Rom:nja öffentlich über ihre Verfolgungsgeschichte während der NS-Zeit. Ihr 1988 erschienener autobiografischer Debütroman „Wir leben im Verborgenen“ trug stark dazu bei, dass das Schweigen rund um den Völkermord an Rom:nja in Österreich gebrochen wurde. Neben ihrer schriftstellerischen und malerischen Tätigkeit kämpfte sie bis an ihr Lebensende als Aktivistin für die Rechte der Minderheit und leistete weltweit wichtige Gedenk- und Aufklärungsarbeit.
Romanes als Sprache vom Aussterben bedroht
Die Sprache der Rom:nja heißt Romanes. Weltweit sprechen sie schätzungsweise 6 Millionen Personen. Sie ist mit dem indischen Sanskrit verwandt und wurde bis in die jüngste Zeit nicht einheitlich verschriftlicht, sondern von Generation zu Generation mündlich weitergegeben. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich zahleiche Dialekte entwickelt, die oft Lehnwörter und sprachliche Eigenheiten aus den Landessprachen der jeweiligen Mehrheitsbevölkerung übernommen haben.
Sprachwissenschaftler:innen gehen davon aus, dass heute nur noch etwa 50 Prozent der Rom:nja Romanes sprechen. Die Sprache wurde während der langen Verfolgungsgeschichte der Minderheit häufig verboten und viele Eltern entschieden aus Angst, dass ihnen dadurch noch mehr Nachteile entstehen könnten, bewusst dagegen, sie ihren Kindern weiterzugeben. Deshalb gilt Romanes aktuell in vielen Ländern als stark gefährdete, vom Aussterben bedrohte Sprache.
Trotz dessen haben sich viele Wörter aus dem Romanes in die Sprachen der Mehrheitsbevölkerungen eingeschlichen. So kommt der Ausdruck „Keinen Bock zu haben“ vom Romanes-Wort „bokh“, das Hunger und im übertragenen Sinn Lust bedeutet. Die umgangssprachlichen ungarischen und deutschen Jugendwörter „csaj“ und „Chaya“ sowie „csávó“ und „Chabo“ für junge Frau bzw. jungen Mann leiten sich beide aus den Romanes-Wörtern „čhaj“ für Mädchen und „shavo“ für Junge ab. Das englische Wort „Lollipop“ lässt sich laut einigen Theorien ebenfalls auf das Romanes zurückführen: Die Rom:nja-Händler:innen, die am Jahrmarkt Zuckeräpfel am Stiel verkauften, bewarben ihre Ware als „Roter Apfel“ – „Loli phaba“ auf Romanes.
Die sechste österreichische Volksgruppe
In Österreich stellen Rom:nja eine autochthone – also einheimische – Volksgruppe dar. Das 1976 beschlossene Volksgruppengesetz definiert Volksgruppen als „in Teilen des Bundesgebietes wohnhafte und beheimatete Gruppen österreichischer Staatsbürger mit nichtdeutscher Muttersprache und eigenem Volkstum“. Aktuell sind anhand von diesen Kriterien neben den Rom:nja noch die Ungar:innen, Slowak:innen, Tschech:innen, Slowen:innen und Kroat:innen staatlich als Volksgruppe anerkannt.
Die Erlangung des Volksgruppenstatus war bereits während der 1980er Jahre ein großes Anliegen der österreichischen Rom:nja-Aktivist:innenbewegung. Das Bundeskanzleramt wies den Antrag zunächst mit der Begründung zurück, dass keine ausreichende Selbstorganisation vorhanden war und dass die Bindung an das österreichische Territorium nicht nachgewiesen werden konnte. Erst im Jahr 1993 wurden Rom:nja als sechste österreichische Volksgruppe anerkannt. Dieser zweite Versuch zur Anerkennung der Volksgruppenstellung wurde durch eine Petition von Rudi Sarközi, dem Gründer des Wiener Kulturvereins österreichischer Roma, und dem Roma Verein Oberwart gestartet und war dank der vorzeigbaren aktivistischen Tätigkeiten und Vereinsgründungen der Rom:nja-Bewegung erfolgreich.
Als Volksgruppe genießen Rom:nja besondere juristische Schutzrechte. Sie haben einen gesetzlichen Anspruch auf finanzielle und sonstige staatliche Förder- und Unterstützungsmaßnahmen zum Schutz und zum Erhalt ihrer Kultur und ihrer Sprache. 1995 wurde zudem der Volksgruppenbeirat der Roma gegründet. Dieser besteht aus alle vier Jahre neugewählten Vertreter:innen der Minderheit und hat als Aufgabe, die Interessen der Volksgruppe zu vertreten und den Bundeskanzler und die Bundesregierung in Volksgruppenangelegenheiten zu beraten.
Historischer Überblick
Verfolgungsgeschichte vom Mittelalter bis 1800: Eine Minderheit ohne jegliche Rechte
Als die Rom:nja im 14. Jahrhundert aus Indien nach Europa kamen, durften sie zunächst noch mit besonderen Genehmigungen durch die Länder des Kontinents reisen. Die ausgestellten Schutzbriefe sollten sie vor Angriffen und Vertreibungen schützen, doch schon bald wurden sie widerrufen. Die Angehörigen der Minderheit wurden von der Mehrheitsgesellschaft zunehmend als „fremd“ und „anders“ wahrgenommen und entwickelten sich in ihren Augen zu Feindbildern und Sündenböcken. Dies führte zu jahrhundertelanger Diskriminierung, Vertreibung und Verfolgung.
Zwischen 1500 und 1800 wurden im Deutschen Reich 148 Gesetze erlassen, die auf die Verfolgung von Rom:nja abzielten. Die Minderheit wurde rechtslos und für vogelfrei erklärt. Somit konnten Rom:nja von jedermann ohne Strafe beraubt, verfolgt, vertrieben und sogar getötet werden. Auch in anderen europäischen Ländern war die Lage der Minderheit kritisch: So wurden Rom:nja in Spanien von der Bevölkerung gejagt und in Rumänien bis 1891 versklavt. Die Niederlassung an einem festen Wohnsitz und die Ausübung der meisten Berufe wurde ihnen nicht erlaubt. Aus diesen Gründen war ein großer Teil der Rom:nja gezwungen, umherzuziehen.
In Österreich und im Heiligen Römischen Reich verschärfte sich die Verfolgung im 18. Jahrhundert weiter. Besonders die radikale Gesetzgebung von Kaiser Karl VI trieb die Gewalt gegen die Minderheit in neue Höhen. Zwischen 1718 und 1725 erließ er mehrere Verordnungen, die männliche Roma mit dem Tod bedrohten und Frauen und Kinder zur lebenslangen Zwangsarbeit verurteilten. Er ordnete zudem die Festnahme und „Ausrottung“ der gesamten Minderheit an. (Quelle: ZENTRUM POLIS, Roma in Österreich. Emanzipation einer Volksgruppe, Nr. 8 (2019), S. 5.; siehe auch Rote Spuren oder Burgenland-Roma)
Von der Aufklärung bis 1933: Berufs- und Sprachverbote, Kindesabnahme und Zwangsarbeit
Auch die Zeit der Aufklärung brachte keine Besserung – im Gegenteil. Die Epoche war europaweit von antiziganistischen Gesetzen geprägt. Der Fokus lag dabei vor allem auf der Zwangsassimilierung. Das bedeutet, Rom:nja dazu zu zwingen, sich der Kultur der Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Unter der Herrschaft von Maria Theresia und Josef II durften Rom:nja ihre traditionellen handwerklichen und musikalischen Berufe nicht länger ausüben. Auch das Umherziehen, das Sprechen von Romanes und die Heirat untereinander wurde ihnen verboten. Kinder ab dem Alter von vier bis fünf Jahren wurden ihren Familien weggenommen und bei Pflegeeltern untergebracht, die sie gegen Bezahlung streng christlich erziehen sollten. Viele Rom:nja-Eltern versuchten, ihre Kinder zurückzuholen. Daraus entstand das Vorurteil, dass Rom:nja Kinderdiebe seien.
Im 19. Jahrhundert wurden neue diskriminierende Gesetze, wie etwa das Reichsschubgesetz und das Landstreichergesetz, verabschiedet. Diese sahen Bestrafungen, Einweisung in Besserungsanstalten und Zwangsarbeit für Menschen ohne festen Wohnsitz oder Einkommen vor. Zwar wurden Rom:nja nicht ausdrücklich in den Gesetzen erwähnt, sie waren jedoch massiv betroffen. Wegen der bestehenden Vorurteile und der seit Jahrhunderten festgesetzten diskriminierenden staatlichen Strukturen war es für Rom:nja sehr schwierig, die Staatsbürgerschaft und die daran geknüpften Rechte und Unterstützungen (etwa Gewerbeberechtigungen) zu bekommen. Die Begriffe „Landstreicher“ und „Bettler“ wurden zunehmend mit Rom:nja gleichgesetzt. Ab 1923 begann die Polizei, die Angehörigen der Minderheit systematisch mit Fotos und Fingerabdrücken zu erfassen.
Porajmos – Der nationalsozialistische Völkermord an Rom:nja
Die Verfolgungsgeschichte der Rom:nja erreichte ihren Höhepunkt während der NS-Herrschaft, mit dem nationalsozialistischen Völkermord. Heute gilt der Begriff „Porajmos“ als das gängigste Wort, um dieses Ereignis zu beschreiben. Es wurde vom amerikanischen Roma-Wissenschaftler Ian Hancock geprägt und bedeutet auf Romanes „Verschlingen“.
Im Jahr 1935 verloren deutsche Rom:nja und Sinti:zze ihren rechtlichen Status als Staatsbürger:innen und auch das Recht auf die Eheschließung mit „Deutschblütigen“. Grund dafür war der Erlass der sogenannten Nürnberger Rassengesetze, in denen sie – wie auch Juden und Jüdinnen – als „artfremd“ bezeichnet wurden. Ihre Lebenssituation verschlechterte sich in den kommenden Jahren drastisch: Es wurden Sondersteuern für sie eingeführt, der Zugang zu Schulen, zur medizinischen Versorgung und zu Dienstleistungen erschwert oder ganz verboten und sie wurden in Ghettos zwangsübersiedelt.
1936 ordnete Heinrich Himmler die „rassenbiologische Erfassung“ aller Rom:nja an. Zu diesem Zweck wurde unter der Leitung von Dr. Robert Ritter eine spezielle Stelle, die „Rassenhygienische Forschungsstelle“ errichtet. Dort wurden Rom:nja untersucht und anhand von scheinwissenschaftlichen Merkmalen „Rassengutachten“ erstellt. Bis Ende 1944 wurden mit diesen Gutachten 24.000 Menschen zu „Zigeunern“ oder „Zigeunermischlingen“ erklärt, zwangssterilisiert und in Konzentrations- oder Vernichtungslager deportiert.
Verfolgung und Deportation österreichischer Rom:nja
Mit dem „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland 1938 begann auch die Verfolgung österreichischer Rom:nja und die Deportation der Minderheit. Rom:nja wurden in Ghettos und Konzentrationslager im nationalsozialistischen Deutschland und im besetzten Polen gebracht und dort zur Zwangsarbeit gezwungen. In Österreich wurden spezielle Anhaltelager errichtet, die als Zwischenstationen für weitere Transporte in Vernichtungslager dienten.
Die Endphase des Völkermordes an Rom:nja begann im Dezember 1942. Heinrich Himmler ordnete mit dem sogenannten „Auschwitz-Erlass“ an, alle noch im Deutschen Reich und in den besetzten Gebieten lebenden Rom:nja in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau zu deportieren. Dort wurden sie in einem eigenen Lagerteil untergebracht. 70 Prozent der über 20.000 dort inhaftierten Menschen starben an Krankheiten, Hunger, Misshandlungen oder als Folge medizinischer Experimente und Zwangssterilisationen unter der Leitung von Dr. Josef Mengele. Das „Zigeunerlager“ wurde im August 1944 aufgelöst. Die noch arbeitsfähigen Häftlinge wurden dabei in andere Konzentrationslager deportiert und die verbleibenden schätzungsweise 4.000 Männer, Frauen und Kinder in der Nacht von 2. auf den 3. August in den Gaskammern von Auschwitz ermordet.
Historiker:innen schätzen [1], dass während des Nationalsozialismus zwischen 500.000 und 1,5 Millionen Rom:nja in den Konzentrationslagern vergast und in medizinischen Anstalten durch „Euthanasie“ ermordet wurden. Die genaue Zahl der Opfer ist bis heute unbekannt. Die Gründe dafür sind einerseits, dass viele Städte und Gemeinden das Schicksal der deportierten Rom:nja nicht aufgearbeitet haben, andererseits, dass viele Rom:nja unter der Kategorie „Asoziale“ in die Lager gebracht wurden. In Österreich wurden etwa 85 bis 90 Prozent der damals hier lebenden Rom:nja getötet. [2]
Schleppende rechtliche und politische Aufarbeitung des Porajmos
Die Diskriminierung der Rom:nja endete auch nach 1945 nicht. Der Großteil der Behörden leugnete, dass sie während der NS-Zeit aus „rassischen“ Gründen verfolgt worden waren. Stattdessen wurden sie als „Asoziale“ oder „Kriminelle“ dargestellt und nach dem Krieg somit von den staatlichen Entschädigungszahlungen ausgeschlossen. In den späteren Richtlinien zu den Entschädigungsgesetzen wurden Rom:nja zwar als „rassisch“ Verfolgte genannt, in der Praxis blieb es aber dennoch sehr schwierig, eine Entschädigung zu bekommen: Viele Anträge wurden abgelehnt, weil die Leidensgeschichten der Antragsteller:innen als unglaubwürdig abgestempelt wurden. Andere Anträge scheiterten an den vielen verlangten Dokumenten, die die Antragsteller:innen oft während des Krieges verloren hatten oder die ihnen die Behörden wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit nie ausgestellt hatten. Personen, die in Zwangsarbeitslagern deportiert wurden, erhielten oft keine Entschädigung, weil nur die Haft in Konzentrationslagern als Entschädigungsgrund anerkannt wurde.
Auch Menschen, die der Zwangssterilisation zugestimmt hatten (etwa unter Drohungen oder ohne Aufklärung), wurden nicht als Opfer anerkannt. Zudem scheiterten auch die Anträge auf Rückgabe von beschlagnahmtem Eigentum, wie Häuser, Möbel und Geld in den meisten Fällen an den bürokratischen Hürden und an den Vorurteilen der Beamt:innen.
Die Bestrafung der Täter:innen des Porajmos blieb ebenfalls fast vollständig aus [3]: Die Kriminalpolizei, die als Hauptorgan für die Verfolgung der Rom:nja zuständig war, wurde nicht als kriminelle Organisation eingestuft. Zwangssterilisationen wurden meistens nicht als NS-Verbrechen gewertet und auch die Mitarbeiter:innen der „Rassenhygienischen Forschungsstelle“, deren „Rassengutachten“ zu tausenden Deportationen und Zwangssterilisationen führten, wurden nie zur Rechenschaft gezogen.
Einstellungen von Strafverfahren
Das Verfahren gegen den Leiter, Dr. Robert Ritter, wurde eingestellt, weil das Gericht die entlastenden Zeugenaussagen von zwei ehemaligen NS-Beamten als glaubwürdiger beurteilte als die Aussagen der Opfer. Ritter konnte seine medizinische Karriere als Leiter der Ärztlichen Jugendhilfestation im Gesundheitsamt Frankfurt am Main weiterführen und verstarb im hohen Alter, ohne jemals für seine Taten bestraft worden zu sein. Auch die später geführten Strafverfahren gegen Ritters Assistentin, Dr. Eva Justin, und 66 weitere Mitarbeiter:innen der „Rassenhygienischen Forschungsstelle“ wurden ohne Verurteilungen eingestellt. Als Begründung dafür wurde angeführt, dass sie nur „Schreibtischtäter:innen“ gewesen seien und dass die Tatbestände der Misshandlung und des rassistischen Gedankengutes bereits verjährt wären.
In den strafrechtlichen Prozessen wurden die Aussagen der Rom:nja Opfer grundsätzlich selten ernst genommen. Die Täter:innen hingegen galten oft als Menschen, die nur unter Druck des NS-Regimes gehandelt hatten und blieben daher ungestraft. Viele von ihnen arbeiteten in der Polizei, in der Verwaltung, in der Justiz und in der Forschung weiter. Alte Akten und „Rassengutachten“ aus der NS-Zeit wurden von der Polizei und von der Wissenschaft weiterbenutzt – die gezielte Überwachung der Rom:nja dauerte in Österreich noch bis in die 1960er Jahre an. Erst durch das Aktivwerden der deutschen, österreichischen und internationalen Rom:nja-Zivilgesellschaft kam es schrittweise zu einem Wandel im politischen Umgang mit den Gräueltaten des Nationalsozialismus.
Internationaler Aktivismus der Rom:nja und Sinti:zze: eigene Nation, Hymne und Flagge
Die ersten politischen Organisationen der Rom:nja wurden bereits in den 1920er Jahren in Bulgarien, Jugoslawien, Rumänien und Griechenland gegründet. Sie verstanden sich als Interessensvertretungen und setzten sich für gleiche Bildungschancen und das Wohlergehen der Minderheit ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden auch in anderen europäischen Ländern wie Frankreich, England, Deutschland und Österreich immer mehr Rom:nja-Bewegungen. Aktivist:innen der Minderheit gründeten Vereine und forderten politische Anerkennung, Wiedergutmachung und Diskriminierungsbekämpfung. Als offizielle Geburtsstunde des internationalen Rom:nja-Aktivismus gilt heute der erste Internationale Roma-Kongress, der 1971 in London stattfand. Bei diesem Kongress erklärten Delegierte aus 14 Ländern, dass Rom:nja eine eigene Nation seien, und dass anstatt der negativen Fremdbezeichnungen (Z-Wort und bedeutungsgleiche Wörter in anderen Sprachen) die Bezeichnung „Rom:nja“ verwendet werden sollte. Sie erklärten weiters das Lied „Gelem gelem“ zur offiziellen Hymne der Rom:nja und entwarfen eine Flagge.
Hungerstreik, Besetzung und Kampagnen für die Anerkennung des Völkermordes
Diese Welle an internationalen Aktivismus führte in den 1970er Jahren auch zur Begründung der Bürgerrechtsbewegung Deutscher Sinti:zze und Rom:nja. Es entstanden viele bedeutende Verbände, darunter auch der Verband Deutscher Sinti und das Zentral-Komitee der Cinti. Die Aktivist:innen der Minderheit organisierten Kampagnen, Gedenkveranstaltungen und Protestaktionen, um Kritik an der Verdrängung des Porajmos zu üben. Dabei gewannen sie viele Unterstützer:innen: Politiker:innen, Künstler:innen, Angehörige anderer NS-Opfergruppen und auch internationale Organisationen, wie das Europaparlament.
Zu den bedeutendsten Aktionen der Bürgerrechtsbewegung gehörten der Hungerstreik im ehemaligen Konzentrationslager Dachau im Jahr 1980 und die Besetzung des Kellers des Tübinger Universitätsarchivs in 1981. Im Jahr 1982 wurde der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma gegründet und als Ergebnis des öffentlichen Drucks schließlich auch der Völkermord an Rom:nja zum ersten Mal offiziell vom damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt anerkannt. Nach dieser späten Anerkennung setzte sich der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma für die Wiedergutmachung der NS-Verbrechen ein, was zu neuen Entscheidungen in über 3.000 Entschädigungsverfahren und zu Wiedergutmachungszahlungen aus diversen Fonds führte.
1995 wurde das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg eröffnet, welches als wichtiger Ort der Erinnerung und Aufklärung über die Geschichte und Kultur der Sinti:zze und Rom:nja diente. Im selben Jahr wurden deutsche Sinti:zze und Rom:nja zudem als nationale Minderheit anerkannt. Als solche genießen sie rechtlich einen besonderen Minderheitenschutz, der mit den Schutzrechten österreichischer Volksgruppen vergleichbar ist. Ein nationales Denkmal für die Opfer des Porajmos wurde in Berlin nach jahrzehntelangen Debatten schließlich im Jahr 2012 errichtet.
Aktivismus in Österreich: Protestbriefe, Vereinsgründungen und offizieller Gedenktag
In Österreich begann die aktivistische Arbeit der Rom:nja erst in den späten 1980er Jahren. Junge Menschen aus der Minderheit, die in der Bildung, in der Arbeitswelt und auch bei Dienstleistungen benachteiligt wurden, schrieben Protestbriefe an den damaligen Bundespräsidenten Kurt Waldheim. Sie forderten Gleichberechtigung und organisierten sich in verschiedenen Vereinen – als bedeutendste Vorreiter des österreichischen Rom:nja-Aktivismus sind hierbei der Oberwärter Verein Roma und die Wiener Vereine Kulturverein österreichischer Roma und Romano Centro zu nennen.
Die Aktivist:innen dieser Bewegung setzten sich für die Verbesserung der Lebenssituation der Minderheit, für die Diskriminierungsbekämpfung sowie für die öffentliche Anerkennung des Porajmos ein. Im Jahr 1988 wurden Rom:nja zum ersten Mal vom damaligen Bundeskanzler Franz Vranitzky ausdrücklich als Opfer des Nationalsozialismus genannt. Seit 1993 sind sie als sechste österreichische Volksgruppe anerkannt. Nach dem rechtsextremen Rohrbombenattentat von Oberwart, bei dem 1995 vier Roma-Männer ums Leben kamen, gründete sich zudem der Volksgruppenbeirat der Rom:nja.
2015 erklärte das Europäische Parlament den 2. August zum Europäischen Holocaust-Gedenktag für Rom:nja. Dies war ein wichtiger Schritt zur europaweiten Aufarbeitung des Porajmos. Der 2. August wurde im Laufe der letzten Jahre von vielen EU-Mitgliedstaaten als offizieller staatlicher Gedenktag anerkannt. Nach langjähriger Forderung der Zivilgesellschaft folgte 2024 auch Österreich diesem Beispiel.
Antiziganismus heute: Von Rassismus bis (staatlicher) Ungleichbehandlung
Antiziganismus: Was ist das?
Trotz der unermüdlichen aktivistischen Arbeit des letzten Jahrhunderts gehören Rom:nja immer noch zur Gruppe der am häufigsten und am gravierendsten diskriminierten Menschen. Sie werden tagtäglich Opfer von rassistischer Gewalt und (staatlicher) Ungleichbehandlung in nahezu allen Lebensbereichen. Der Begriff „Antiziganismus“ steht dabei für eine besondere Form des Rassismus, der sich gegen Rom:nja und auch gegen Personen richtet, die wegen rassistischen Stereotypen als Rom:nja wahrgenommen werden. Das Phänomen wird nach der Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance wie folgt beschrieben:
„Antiziganismus manifestiert sich in individuellen Äußerungen und Handlungen sowie institutionellen Politiken und Praktiken der Marginalisierung, Ausgrenzung, physischen Gewalt, Herabwürdigung von Kulturen und Lebensweisen von Sinti und Roma sowie Hassreden, die gegen Sinti und Roma sowie andere Einzelpersonen oder Gruppen gerichtet sind, die zur Zeit des Nationalsozialismus und noch heute als „Zigeuner“ wahrgenommen, stigmatisiert oder verfolgt wurden bzw. werden. Dies führt dazu, dass Sinti und Roma als eine Gruppe vermeintlich Fremder behandelt werden, und ihnen eine Reihe negativer Stereotypen und verzerrter Darstellungen zugeordnet wird, die eine bestimmte Form des Rassismus darstellen.“
Demnach zeigt sich Antiziganismus auf zwei Arten: Einerseits durch tatsächliche Diskriminierung und Gewalt gegen Rom:nja – und als solche wahrgenommene Personen -, andererseits durch eine rassistische Denkweise, die auf negativen Vorurteilen beruht. Daher ist beispielsweise die verallgemeinernde Darstellung der Minderheit der Rom:nja als Bettler:innen oder Kriminelle in Filmen und Büchern antiziganistisch. Diese Zuschreibungen hängen nicht mit der ethnischen Zugehörigkeit der Betroffenen zusammen, sondern basieren viel mehr auf rassistischen Stereotypen. Auch die Darstellung der Rom:nja als unbeschwertes reisendes Volk ist aber als antiziganistisch zu werten. Diese Vorstellung beruht auf Klischees und lässt unbeachtet, dass Rom:nja zum Umherziehen gezwungen waren, weil sie jahrhundertelang immer wieder vertrieben und verfolgt wurden, und dass heute schätzungsweise 97 Prozent der Minderheit sesshaft leben.
Diskriminierung in Europa: Bis zu 10 Jahre kürzere Lebenserwartung
Aus den aktuellen Berichten der deutschen Melde- und Informationsstelle Antiziganismus, von Amnesty International und des European Roma Rights Center geht hervor, dass europaweit sehr viele Rom:nja im Bildungswesen, am Arbeitsmarkt, im Gesundheitswesen, in den medialen Berichtserstattungen und auch beim Zugang zu Dienstleistungen benachteiligt werden. Die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus verzeichnete für das Jahr 2024 alleine in Deutschland 1.678 antiziganistische Vorfälle (+40% im Vgl. zum Vorjahr).
Sie werden häufig zu Opfern von Polizeigewalt sowie von rechtsextremen Übergriffen. In vielen europäischen Ländern leben sie ausgegrenzt unter elenden Bedingungen. Beispielsweise in Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Italien und Frankreich haben viele Rom:nja-Siedlungen nicht einmal Fließwasser und kaum bis keine Infrastruktur. Rom:nja-Kinder werden oft ungerechtfertigt Förderschulen zugewiesen und sowohl von Lehrer:innen als auch von Mitschüler:innen diskriminiert.
In der Slowakei und auch in anderen osteuropäischen Ländern herrscht vielerorts immer noch Segregation – Rom:nja-Schüler:innen werden von ihren Nicht-Rom:nja-Mitschüler:innen getrennt und in eigenen, schlechter ausgestatteten Schulen oder Klassen unterrichtet. Laut EU-Erhebungen schließen 50 Prozent weniger Rom:nja als Nicht-Rom:nja eine höhere Ausbildung ab. Die Diskriminierung in der Arbeitswelt und beim Zugang zu medizinischen Behandlungen führen dazu, dass der Anteil an arbeitslosen Personen aus der Minderheit um 30 Prozent höher ist als bei der restlichen Bevölkerung und dass die Lebenserwartung von Rom:nja um 5 bis 10 Jahre unter dem europäischen Durchschnitt liegt.
Die Europäische Union beschloss im Rahmen ihrer Strategie für den Zeitraum 2020 bis 2030, stärker gegen Diskriminierung und Vorurteile vorzugehen und an der Gleichstellung und Inklusion der Minderheit zu arbeiten. Um diese Ziele zu erreichen sind tiefgreifende Veränderungen in den staatlichen Systemen – Schulen, Universitäten, Behörden, Gesundheitseinrichtungen – notwendig. Rom:nja-Vereine, NGOs und internationale Menschenrechtsorganisationen setzen sich tagtäglich dafür ein, die Situation der Minderheit sichtbar zu machen und diese Veränderungen tatsächlich voranzutreiben und zu verwirklichen.
Antiziganismus in Österreich: eine der „salonfähigsten“ Arten des Rassismus
Antiziganismus gehört in Österreich und auch weltweit weiterhin zu den „salonfähigsten“ Arten des Rassismus: Die Verwendung des Z-Wortes, die auf Vorurteilen beruhende Darstellung der Minderheit in Büchern und Filmen sowie die unbegründete Zuschreibung von stereotypischen Merkmalen werden nur selten von der Gesellschaft missbilligt. Auch das weiterhin fehlende öffentliche Bewusstsein für den NS-Völkermord zeigt, wie tief dieser Rassismus verankert ist. Beim Erinnern an die Gräueltaten des Nationalsozialismus und auch in den meisten Lehrbüchern werden Rom:nja auch heute noch häufig nur beiläufig oder im Nebensatz erwähnt.
Einen offiziellen Antiziganismus-Bericht gibt es in Österreich nicht. Der Verein Romano Centro veröffentlichte allerdings 2017 die dritte Fall-Dokumentation, in der sie Fälle von Antiziganismus sammeln. Es umfasst unter anderem die Bereiche Internet, öffentlicher Raum, (rechtsextreme) Medien, Polizei, Bildung oder Arbeitswelt.
Österreichische Rom:nja-Organisationen
Hango Roma – Setzt sich für den Erhalt der Kultur und für die Gleichberechtigung der Rom:nja ein und leistet Gedenkarbeit.
HÖR – Hochschüler*innenschaft Österreichischer Roma und Romnja – Der erste österreichische Jugendverein der Rom:nja. Vertritt die Interessen der jüngsten Generation der Volksgruppe, fungiert als Vernetzungsplattform und leistet Gedenk- und Sensibilisierungsarbeit.
Kulturverein Österreichischer Roma – Leistet wissenschaftliche Arbeit hinsichtlich der Aufarbeitung und Wahrung der Geschichte der österreichischen Rom:nja, setzt sich für die Stärkung des Volksgruppenbewusstseins und für die sozialen und politischen Interessen der Minderheit ein.
Newo Ziro – Sinti Kulturverein, der sich für die Bewahrung, Entwicklung und Förderung der Sprache, Kultur und Traditionen der österreichischen Sinti:zze einsetzt und Aufklärarbeit leistet.
Roma Volkshochschule Burgenland – Verein mit der Zielsetzung, die Allgemein- und Erwachsenenbildung von, mit und über Rom:nja zu fördern.
Romano Centro – Setzt sich durch Beratung, Bildung, Informations- und Sensibilisierungsveranstaltungen sowie durch Arbeit mit Jugendlichen und Schulmediation gegen Diskriminierung und für bessere Lebensumstände für Rom:nja ein.
Romano Svato – Theaterkollektiv, das sich künstlerisch mit der Rom:nja-Kultur und -Identität auseinandersetzt und das Empowerment der Volksgruppe als Ziel hat.
Verein Roma Service – Setzt sich für die Förderung, Bewahrung und Dokumentation der Kultur der Burgenland-Roma ein – mit besonderem Fokus auf den Erhalt des Romani-Dialekts der Burgenland-Roma.
Vivaro – Der erste österreichische Frauenverein der Rom:nja. Die Arbeit des Vereins umfasst u.a. Vernetzung und Austausch in einem Safe Space, die Entwicklung eines Bewusstseins für die Wichtigkeit von Bildung und Gesundheit und die Ausbildung von Aktivistinnen.
Voice of Diversity – Verein mit der Zielsetzung, die Kunst und Kultur der Minderheit zu fördern und die breite Öffentlichkeit über Geschichte, Tradition und Kultur der Rom:nja zu informieren.
Internationale Rom:nja-Organisationen
Amaro Foro – Jugendselbstorganisation, die sich gegen Antiziganismus sowie für Teilhabe und Chancengerechtigkeit einsetzt. Sie leistet Sensibilisierungsarbeit und unterstützt Rom:nja im sozialen Bereich.
ERGO Network – Verbindung diverser internationaler Organisationen und Einzelpersonen, die sich gemeinsam gegen Antiziganismus und für die Verbesserung des Lebensumstände von Rom:nja einsetzen.
ERIAC – European Roma Institute for Arts and Culture – Eine Initiative, die sich für die Anerkennung der Kunst und Kultur der Minderheit der Rom:nja einsetzt.
ERRC – European Roma Rights Center – Eine von Rom:nja geführte internationale Organisation, die sich in erster Linie durch juristische Arbeit (etwa durch die Einbringung von Klagen) für die Rechte von Rom:nja einsetzt.
IRU – International Romani Union – Transnationale Interessensvertretung für Rom:nja, die als Dachverband für zahlreiche nationale Organisationen dient.
MIA – Melde- und Informationsstelle Antiziganismus – Deutsche Organisation, die sich für die Interessen von Personen einsetzt, die von Antiziganismus betroffen sind. Sie sammelt und analysiert gemeldete Fälle und bietet juristische, soziale und psychosoziale Unterstützung, Beratung und Begleitung an.
Roma Support Group – Von Rom:nja geführter britischer Verein, der Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit leistet und Beratung und Unterstützung für Rom:nja-Migrant:innen anbietet.
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma – Politische und bürgerrechtliche Interessensvertretung der deutschen Sinti:zze und Rom:nja. Fungiert als Dachverband für 19 Landes- und Mitgliedsverbände.
Wichtige Feier- und Gedenktage der Rom:nja
8. April – Internationaler Roma-Tag
Seit 1990 wird am 8. April jährlich weltweit der Internationale Roma-Tag begangen. An diesem Tag wird durch verschiedene Veranstaltungen und Aktionen die Kultur der Rom:nja gefeiert, die Erfolge und Bemühungen der Bürgerrechtsbewegung gewürdigt sowie auf die Situation der Minderheit aufmerksam gemacht. Der historische Hintergrund des Tages ist, dass der erste Welt-Roma-Kongress in London am 8. April 1971 begann.
6. Mai – Ederlezi
Ederlezi ist ein Feiertag, den vor allem muslimische und christlich-orthodoxe Rom:nja in den Westbalkanländern feiern. An diesem Tag wird im Kreise der Familie und Freunde mit gemeinsamen Essen, Musik und Tanz der Frühling begrüßt.
16. Mai – Rom:nja-Widerstandstag
Am 16. Mai 1944 planten die Nationalsozialist:innen die Auflösung des „Z*geunerlagers“ im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Die dort inhaftierten 6.000 Rom:nja sollten an diesem Tag ermordet werden, wurden aber von einem anderen Häftling gewarnt. Sie bewaffneten sich mit Stöcken und den Werkzeugen, mit denen sie ihre Zwangsarbeit verrichten mussten, verbarrikadierten die Baracken und leisteten bewaffneten Widerstand gegen die Männer der SS. Dieser Widerstand konnte die Ermordung der Rom:nja zunächst verhindern. Etwa die Hälfte der Häftlinge wurde in andere Lager deportiert – um einen weiteren Angriff auf die Aufseher:innen zu verhindern – wodurch viele von ihnen überlebten. Heute ist der 16. Mai einerseits ein Tag des Gedenkens, andererseits aber auch ein Tag, an dem die Stärke und Widerstandsfähigkeit der Rom:nja gefeiert wird.
2. August – Europäischer Holocaust Gedenktag für Rom:nja und Sinti:zze
1944 ermordeten die Nationalsozialisten in der Nacht vom 2. auf den 3. August alle noch im „Zigeuner-Lager“ von Auschwitz-Birkenau verbliebenen Häftlinge in den Gaskammern. An diesem Tag wird seit 2015 den über 500.000 Rom:nja gedacht, die aufgrund der rassistischen NS-Verfolgungspolitik ihr Leben verloren.
[1] RANDJELOVIĆ, Isidora, Erinnerungsarbeit an den Porajmos im Widerstreit. Gegen Epistemo- logien der Ignoranz, in: Iman Attia / Swantje Köbsell / Nivedita Prasad (Hrsg.), Dominanz- kultur Reloaded. Neue Texte zu gesellschaftlichen Machtverhältnissen und ihren Wechsel- wirkungen, Bielefeld 2015, S. 90.
LOTTO-KUSCHE, Sebastian, Der Völkermord an den Sinti und Roma und die Bundesrepublik. Der lange Weg zur Anerkennung 1049-1990, München-Wien 2022, S. 12.
[2] Vgl.: Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen seit 1945 in Österreich: Forschungsbericht der Historikerkommission der Republik Österreich. Zusammenfassungen und Einschätzungen. Schlussbericht. Historikerkommission der Republik Österreich, 2003, https://images.derstandard.at/20030227/INTSCHLUSSBERICHT.pdf
[3] Schlussfolgerung aufgrund des beschriebenen Verlaufs der strafrechtlichen Verfahren – Quellen zu diesen:
GRESS, Daniela, Nachgeholte Anerkennung. Sinti und Roma als Akteure in der bundesdeutschen Erinnerungskultur. In: Philipp Neumann-Thein / Daniel Schuch / Markus Wegewitz (Hrsg.), Organisiertes Gedächtnis. Kollektive Aktivitäten von Überlebenden der national- sozialistischen Verbrechen, Göttingen 2022, S. 429, 438-443.
GILAD, Margalit, Germany and Its Gypsies. A Post-Auschwitz Ordeal, Wisconsin 2002, S. 133, 138-140.
RANDJELOVIĆ, Isidora, Erinnerungsarbeit an den Porajmos im Widerstreit. Gegen Epistemo- logien der Ignoranz, in: Iman Attia / Swantje Köbsell / Nivedita Prasad (Hrsg.), Dominanz- kultur Reloaded. Neue Texte zu gesellschaftlichen Machtverhältnissen und ihren Wechsel- wirkungen, Bielefeld 2015, S. 92.