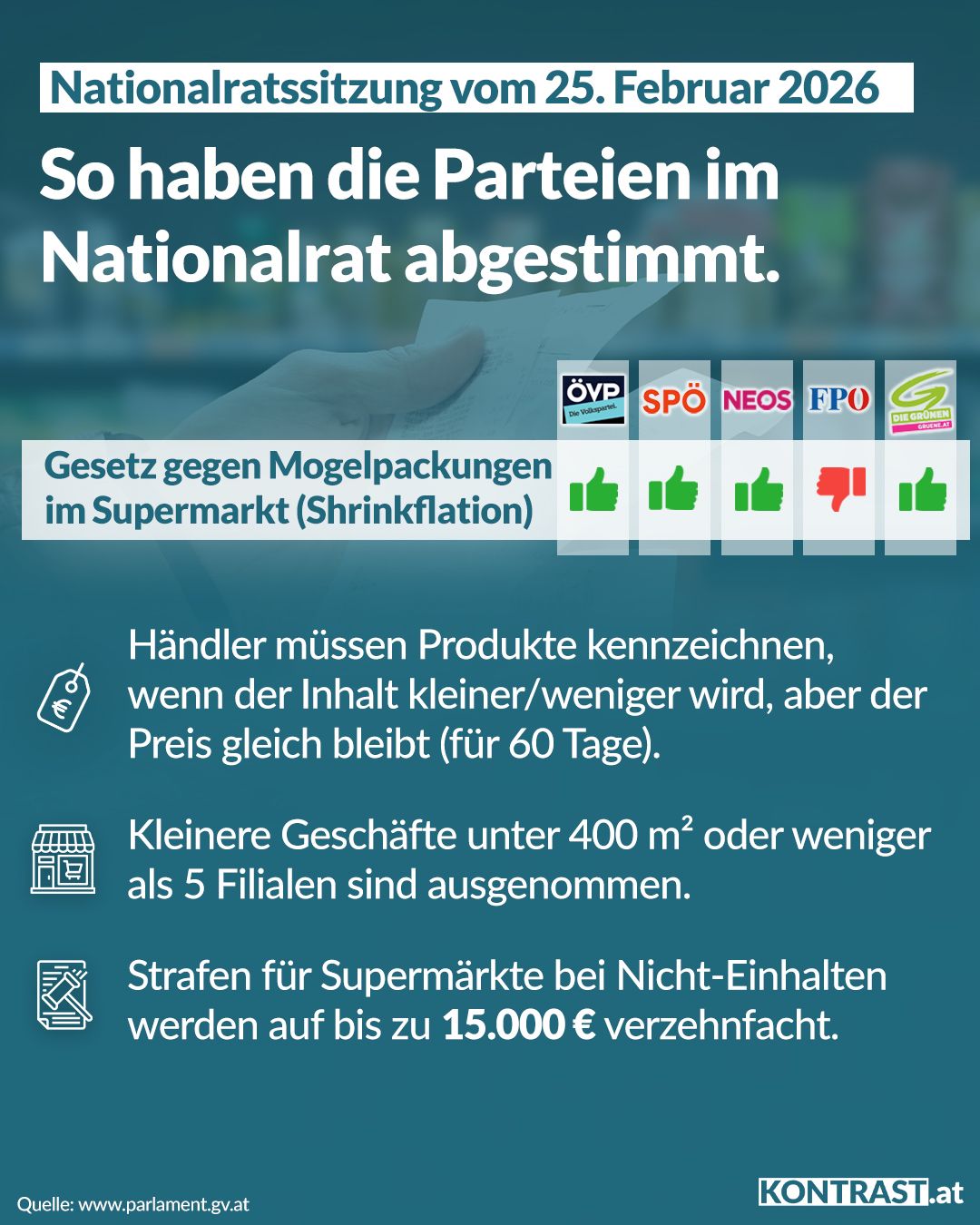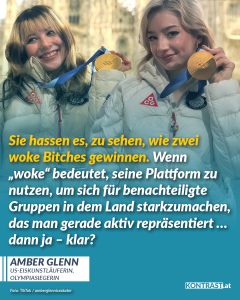Die Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik feiert achtzigsten Geburtstag – gerade jetzt lohnt sich der Blick zurück zu den Anfängen. Ein Leserbrief von Josef Falkinger. Er ist Arbeiterkammerrat sowie Betriebsrat und arbeitet als Volkswirt in Wien.
Der Rückblick auf die ersten Jahrzehnte der zweiten Republik war in der jüngeren Zeit oft von kritischen Befunden beherrscht. So etwa vom Hinweis auf die mangelhafte Aufarbeitung des Nationalsozialismus, die Verdrängung durch die Eigendarstellung als erstes Opfer des Faschismus, den kulturellen Konservativismus der Nachkriegsjahre oder den Proporz. Über der berechtigten Kritik wird oft vergessen, dass die zweite Republik über Jahrzehnte hinweg auch eine spektakuläre und zunächst unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte war.
Aus Armut und Not zu einem der reichsten Länder der Welt
Die Bedingungen für die Errichtung einer stabilen Republik waren 1945 nicht eben günstig: Österreich war ein zerbombtes Land und die unmittelbare Versorgung von Hilfspaketen aus dem Ausland abhängig. Sieben Jahre lang herrschte die nationalsozialistische Gewaltherrschaft, davor 4 Jahre der austrofaschistische Ständestaat. Es gab 1945 540.000 registrierte ehemalige nationalsozialistische Parteimitglieder.
Die erste Republik (1918 bis 1933) war von einer politischen Zerrissenheit geprägt, die bis zum Bürgerkrieg im Februar 1934 führte. Die Wirtschaftskrise 1931 brachte Massenarbeitslosigkeit und sogar Hunger mit sich. Die ökonomische Überlebensfähigkeit stand infrage.
Aus dieser Ausgangslage heraus gelang es den gegnerischen politischen Lagern der Zwischenkriegszeit, deren Wehrorganisationen sich noch 1934 mit der Waffe in der Hand gegenüberstanden, gemeinsam eine stabile Republik aufzubauen, die zunehmend die Unterstützung und das Vertrauen der Bevölkerung gewann. Es gelang, die wirtschaftspolitischen Weichen so zu stellen, dass die österreichische Wirtschaft zuerst in den 70er Jahren die westeuropäischen Ökonomien einholte und dann in den 80er, 90er Jahren zu einem der reichsten Länder der Welt wurde.
Gerade jetzt, in einer Zeit der Instabilität und der Polarisierung, mit multiplen Krisen und einem weltweit erstarkenden Rechtsextremismus, lohnt sich die Frage: Was haben die Gründer:innen unserer Republik damals richtig gemacht? Wie konnten sie die Republik stabilisieren? Wie gelang es ihnen, die Wirtschaft in Gang zu setzen, die Arbeitslosigkeit zurückzudrängen und die Inflation im Zaum zu halten? Wie konnten die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer:innen und die der Bürgerlichen ihre Differenzen überbrücken und tragfähige Kompromisse finden?
Tragfähige Kompromisse
Ob nun die gemeinsame Erfahrung mit der nationalsozialistischen Diktatur, der Druck der Besatzungsmächte oder das unmittelbare Gebot des Wiederaufbaus den Ausschlag zur gemeinsamen Zusammenarbeit gaben, Tatsache ist, dass SPÖ und ÖVP in den ersten 15 Jahren gerade auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik eine Reihe wirklich tragfähiger Kompromisse in Schlüsselfragen erwirken konnten. Eine wesentliche Rolle spielten dabei die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer:innen (ÖGB und Arbeiterkammer), der Wirtschaftstreibenden (Wirtschaftskammer) und der Landwirte (Landwirtschaftskammer). Es waren Kompromisse, die nicht zur gegenseitigen Blockade führten, sondern ganz im Gegenteil zu erfolgreichen Lösungswegen, mit denen sich breite Bevölkerungsschichten identifizieren konnten. Aufgrund der Tragfähigkeit dieser Kompromisse wurde aus der Zusammenarbeit im Wiederaufbau und zur Erlangung eines Staatsvertrages eine strategische Zusammenarbeit für einige Jahrzehnte geschaffen. Die Kreativität der Kompromissfindung soll hier anhand von drei Beispielen veranschaulicht werden: Inflationsbekämpfung, Industriepolitik und Infrastruktur sowie die Globalsteuerung der wirtschaftlichen Entwicklung.
a) Inflationsbekämpfung
Aufgrund der Knappheit an Gütern und der starken Investitionstätigkeit im Zuge des Wiederaufbaus war die Inflationsgefahr ab Tag 1 der neuen Republik eine der dringlichsten Herausforderungen. Hinzu kam, dass die Gewerkschaften deutlich gestärkt aus dem Krieg hervorgingen und in der Lage waren, hohe Lohnforderungen zu stellen. Die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale lag in der Luft. Für dieses Dilemma fanden die drei Kammern und der ÖGB eine kreative Lösung. Der ÖGB war bereit, einen Kurs der Lohnzurückhaltung zu akzeptieren, wenn im Gegenzug die Arbeitgeberseite bereit war, den Preisauftrieb wirkungsvoll zu bekämpfen. Zuerst wurde dieser Kompromiss im Wege von per Generalkollektivvertrag ausgehandelten Lohn-Preisabkommen vereinbart. Schlussendlich gipfelte diese koordinierte Lohn- und Preispolitik der Interessensvertretungen in der Einrichtung der sozialpartnerschaftlich besetzten und monatlich tagenden Paritätischen Kommission für Lohn- und Preisfragen. Die Preisregulierung bestand dabei nicht in staatlich festgesetzten Preisen. Preissteigerungen waren durchaus möglich, mussten aber auf Branchenebene mit einer gestiegenen Kostenstruktur argumentiert und bei der Paritätischen Kommission beantragt werden. Auf diese Weise sollte verhindert werden, dass Unternehmen ihre Marktmacht beispielsweise aufgrund von Lieferkettenengpässen dafür nutzen, Preise über den Anstieg der Kosten hinaus zu erhöhen (Sellers – Inflation). Im Gegenzug mussten auch die Gewerkschaften ihre Lohnforderungen per Antrag der Diskussion in der Kommission unterziehen. Bemerkenswert ist, dass es die Wirtschaftskammern selbst waren, die die Einhaltung der Preisdisziplin durchsetzten, während der ÖGB für die Einhaltung der Lohndisziplin Sorge trug.
b) Industrie- und Infrastrukturoffensive
1945 lagen weite Teile der 1938 bis 1945 geschaffenen Rüstungsindustrie auf österreichischem Boden in deutschem Eigentum. Um einer Beschlagnahmung der Betriebe durch die Besatzungsmächte zu entgehen, konnte auch die ÖVP für eine Verstaatlichung gewonnen werden, obwohl diese eine solche im Grunde ideologisch ablehnte. Jetzt stellte sich aber die Frage, welche Rolle diese Verstaatlichte in der neuen Republik spielen sollte. Und hier kam es zu einer weiteren kreativen Kompromissfindung: Die SPÖ konnte weitgehende Investitionen in den Ausbau und die Elektrifizierung der Bahn, in den Ausbau der Wasserkraftwerke und den Umbau der verstaatlichten Industrie auf zivile Produktion durchsetzen. Im Gegenzug wurden eine Reihe von Maßnahmen gesetzt, um den Nettobetriebsüberschuss privater Unternehmen zu erhöhen: Trotz hoher Wachstumsraten der Wirtschaft kam es aufgrund der Lohnzurückhaltung des ÖGBs 1945 kaum zu Reallohnsteigerungen, das Wachstum kam den privaten und öffentlichen Unternehmen zugute. Es wurde ein Abschreibungsreglement eingeführt, das den Unternehmen ermöglichte, Anlagen sehr schnell abzuschreiben. Damit konnten Unternehmen sehr viel von der Steuer absetzen, wenn sie ihren Gewinn unmittelbar wieder reinvestierten. Unternehmen wurden zudem seitens der Kontrollbank mit Exportkrediten unterstützt, die 1954 mit einer Exportrisikohaftung ergänzt wurde. Die verstaatlichte Industrie versorgte die privaten Unternehmen mit billigen Vorprodukten unter Weltmarktpreis (Rohstahl). Durch den ERP Fonds der Marshallplanhilfe und die in Gemeineigentum übergegangenen Banken konnte Kapital zu günstigen Bedingungen in die Schlüsselindustrien und den Aufbau erfolgreicher mittelständischer Industriebetriebe gelenkt werden. Die auf diese Art herbeigeführte außergewöhnlich hohe Investitionsquote kam wiederum den Arbeitnehmer:innen zugute. Sie führte zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit bis hin zur Vollbeschäftigung. Es wurde ein wirtschaftliches Fundament geschaffen, das es dem ÖGB erlaubte, einen schrittweisen Auf- und Ausbau der sozialen Sicherungssysteme, eine schrittweise Verkürzung der Arbeitszeit und eine Ausdehnung der Urlaubstage durchzusetzen. Ab 1955 kam es zum Anstieg der Reallöhne. Der strategische Fokus des ÖGBs lag jedoch in den ersten 10 Jahren stark auf dem Aufbau einer lebensfähigen und wettbewerbsfähigen Industrielandschaft.[2] Der langjährige ÖGB Präsident Anton Benya fasste diesen Fokus mit den Worten zusammen: „Wenn wir die Kuh melken wollen, müssen wir sie auch füttern.“ Sein Vorgänger Johann Böhm prägte die Worte: „Wir müssen produzieren bevor wir konsumieren können.“ Die Lohnzurückhaltung wurde aber nur in Kauf genommen, weil die Unternehmensgewinne in erster Linie in den Aufbau der Wirtschaft investiert und nicht ausgeschüttet wurden.[3]
c) Globalsteuerung der Wirtschaft
Bei einer Betrachtung der Kompromissfindung in den ersten Jahrzehnten fällt die strategische Weitsicht auf, der Fokus auf die langfristige gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Dieser Fokus entsprang der schmerzlichen Erfahrung einer fehlenden lebensfähigen Wirtschaftsgrundlage aus der Zeit zwischen den Kriegen (1918 bis 1938). Entscheidungen, mit Wasserkraft eigene Energiequellen zu erschließen, auf eine strombetriebene Bahn zu setzen und eine eigene Stahlindustrie fortzuführen, sind sicherlich dahingehend als Schlüsselentscheidungen zu werten. Ebenso die Entscheidung, erfolgreiche exportorientierte Industrieunternehmen aufzubauen, um Devisen für Importe zu bekommen und damit eine ausgeglichene Außenhandelsbilanz sowie eine stabile Währung zu sichern. Diese komplexen Anforderungen führten in der Praxis dazu, dass sich eine Globalsteuerung der Wirtschaft herausbildete, mit der Lohnpolitik, Preispolitik, Außenhandelspolitik, Industrie- und Infrastrukturpolitik sowie Budgetpolitik aufeinander abgestimmt wurden, um die Ziele Vollbeschäftigung, Wirtschaftswachstum, gerechte Einkommensverteilung, niedrige Inflation und harte Währung unter einen Hut zu bringen.[4] In einem zunehmend institutionalisierten Rahmen koordinierte sich die Regierung mit den Kammern und dem ÖGB, damals noch Wirtschaftspartner genannt. Diese Globalsteuerung der Wirtschaft war sicherlich auch ein Kompromiss zwischen dem Streben von Teilen der SPÖ nach stärkeren Planungselementen (etwa angelehnt an der französischen „planification“) und dem Ziel des Wirtschaftsbundes um Raab, die wirtschaftliche Entwicklung stärker den Märkten zu überlassen. Der auf diese Weise entstandene Policy Mix erwies sich als äußerst erfolgreich: Im Vergleich zum westeuropäischen Durchschnitt konnten höhere Wachstumsraten, niedrigere Arbeitslosigkeit und niedrigere Inflationsraten erreicht werden.[5]
Keine geborenen Sozialpartner:innen
Die kreativen Kompromisse, die in den ersten Jahrzehnten der zweiten Republik gefunden wurden, sind umso beeindruckender, als die handelnden Personen alles andere waren als geborene Sozialpartner:innen. Auf der ÖVP-Seite findet sich eine Politikergeneration, die unter Engelbert Dollfuß politisch sozialisiert wurde: Der spätere Bundeskanzler Leopold Figl war 1933 Führer der Ostmärkischen Sturmscharen, einer paramilitärischen Einheit der Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur (1933 bis 1938). Sein Nachfolger als Kanzler Julius Raab legte 1930 als Führer der Niederösterreichischen Heimwehr, dem Vorläufer der Sturmscharen, auch den Korneuburger Eid der Heimwehren[6] ab, der die Beseitigung der parlamentarischen Demokratie forderte. SPÖ-Politker:innen im Jahr 1945 wie Vizekanzler Adolf Schärf waren wiederum vom theoretischen System des Austromarxismus geprägt. Dieser bekannte sich zwar im Gegensatz zum Austrofaschismus zur parlamentarischen Demokratie, sah aber bürgerliche Parteien als Klassengegner an, mit denen es – wenn überhaupt – nur kurzfristige Zweckbündnisse geben konnte. Erklärtes Ziel war die schrittweise Vollsozialisierung und Enteignung der privaten Unternehmen (außer der Landwirtschaft und Kleinbetrieben). Unter dem Dollfuß-Regime wurde die gesamte spätere SPÖ- und Gewerkschaftsführung, darunter Adolf Schärf, Johann Böhm, Karl Seitz, Bruno Kreisky, Rosa Jochmann und Franz Olah verhaftet. Der spätere Vize-Kanzler Schärf verbrachte zuerst lange Monate in Einzelhaft in der Rossauer Kaserne und später im Anhaltelager Wöllersdorf. Wie war es möglich, dass sich aus einer derart verfahrenen Situation nach 1945 ein jahrzehntelanges strategisches Bündnis formieren konnte?
Lernprozesse aus schmerzhaften Niederlagen
Der wesentliche Punkt, der zum Umdenken führte, war das gemeinsame Erlebnis des triumphierenden Nationalsozialismus 1938. In den Konzentrationslagern, den Gefängnissen, im Exil oder der illegalen politischen Tätigkeit während der Zeit des Nationalsozialismus (1938 -1945) fand jeweils eine tiefgreifende Reflexion über die Gründe der Niederlage der sozialdemokratischen Bewegung auf der einen und der christlich-sozialen Bewegung auf der anderen Seite statt. Zwischen einstigen Gegnern wie dem späteren ÖGB Chef Franz Olah und dem späteren ÖVP-Kanzler Leopold Figl entstanden im Konzentrationslager lebenslange Freundschaften. Bürgerlich-konservative Kreise erkannten zunehmend die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit mit Gewerkschafter:innen und Sozialdemokrat:innen. So versuchte die Widerstandsgruppe um Stauffenberg letztere für die Beteiligung an einer zukünftigen Regierung nach Hitler zu gewinnen.[7] Adolf Schärf beschreibt in seinem Buch Österreichs Erneuerung,[8] wie er diesbezüglich von Willhelm Leuschner und dem christlichsozialen Dr. Hurdes in Wien kontaktiert wurde. Auf der sozialdemokratischen Seite kam man speziell über Auslandsorganisationen im Exil in England, den USA und Schweden[9] mit einer neuartigen Form von Politik in Berührung. Während in Europa der Faschismus triumphierte und bürgerlich-konservative Parteien in der Anfangsphase wesentlich zu diesem Triumph beitrugen[10], kam es in den USA, in England und Schweden zu einer anderen Entwicklung. Dort gelang es den Gewerkschaften (USA) und der Sozialdemokratie (GB, Schweden) strategische Bündnisse mit bürgerlichen Parteien zu formen, die nicht nur die Demokratie stärkten, sondern auch mit einem Ausbau des Sozialstaates einhergingen und mit Hilfe keynesianisch geprägter staatlicher Eingriffe Wege aus der Wirtschaftskrise aufzeigten.
Der New Deal und das Schwedische Modell
Bruno Kreisky beschreibt in seinen Erinnerungen[11], wie er, zutiefst frustriert von der Niederlage der österreichischen Sozialdemokratie, in Schweden neue Hoffnung schöpfte. Seine Bilanz der Zwischenkriegszeit war, dass sowohl die radikale oppositionelle Klassenkampfpolitik als auch der sterile Reformismus einer Regierungsbeteiligung ohne wirkliche Gesellschaftsveränderung zum Scheitern verurteilt sind. Die schwedische Erfahrung verwies aber auf eine dritte Möglichkeit: den gestaltenden Reformismus. Dieser umfasst neben einer Regierungsbeteiligung der Arbeiter:innenorganisationen wirkliche gesellschaftliche Verbesserungen, eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung und schlussendlich eine Teilhabe der Arbeiter:innen an den wirtschaftlichen Entscheidungen. Mit dem schwedischen Wohlfahrtsstaat, aber auch mit dem New Deal in den USA und in Großbritannien entstanden Modelle, die in der schwierigen ökonomischen und politischen Krise der Zwischenkriegszeit nicht nur eine Stabilisierung der Demokratie erreichen konnten, sondern auch eine Mobilisierung von Massenunterstützung und Patriotismus für eine republikanische Staatsform. Sozialdemokrat:innen wie Bruno Kreisky und Willy Brandt erkannten nun in diesen Modellen das Potenzial, den Faschismus in seinem Siegeszug aufzuhalten.
Wechselseitige programmatische Umorientierung
Bedingung für ein strategisches Bündnis zwischen Sozialdemokratie und bürgerlich-konservativen Kräften war eine ideologische Neuorientierung auf beiden Seiten. Erstere mussten private Unternehmen und Märkte als notwendige Bestandteile eines erfolgreichen Wirtschaftslebens anerkennen und sich vom Ziel der Vollsozialisierung verabschieden. Letztere mussten demgegenüber die Notwendigkeit von Staatseingriffen anerkennen, wenn Märkte versagten, Marktmacht den Wettbewerb verzerrte oder eine Verfestigung makroökonomischer Ungleichgewichte drohte. Sie mussten den Organisationen der Arbeitnehmer:innen auf betrieblicher und gesamtwirtschaftlicher Ebene wirkliche Mitbestimmung auf Augenhöhe einräumen und sich von der Ideologie des Laissez-faires verabschieden. Die Umorientierung ist auf sozialdemokratischer Seite etwa in den Parteiprogrammen 1958 bis 1978 in der zunehmenden programmatischen Orientierung auf eine sogenannte gemischte Wirtschaft (mixed economy) sichtbar; der Fokus wird von den Eigentumsverhältnissen und von der Frage der Verstaatlichung zunehmend auf die Frage der Entscheidungsverhältnisse und der Mitbestimmung verschoben. Gleichzeitig ermöglicht auf konservativer Seite die Theorie der sozialen Marktwirtschaft von Müller-Armack eine Öffnung in Hinblick auf Staatseingriffe auf Basis von Marktversagen. Auch der Ordoliberalismus von Walter Eucken fordert Staatseingriffe bei Marktmacht und Markversagen und kritisiert den Laissez-faire Liberalismus der Zwischenkriegszeit. Damit tat sich die Möglichkeit auf, faktenbasiert auf Expert:innenebene über konkrete Staatseingriffe und wirtschaftspolitische Maßnahmen der Globalsteuerung zu diskutieren und diese zu evaluieren. Der Wirtschaftshistoriker Felix Butschek beschreibt, dass in den 60er Jahren unter den Expert:innen des WIFOs, der Nationalbank und der Wirtschaftspartner über den regelmäßig tagenden Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen und dessen Unterausschüssen ein ausgezeichnetes Diskussionsklima herrschte, wo oft schneller faktenbasierte Lösungen gefunden wurden als auf der Funktionärsebene.[12]
Konfliktpartnerschaft
Es wäre falsch, sich die sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit in der zweiten Republik als romantische Liebesheirat vorzustellen. Die Zusammenarbeit musste immer wieder erarbeitet und errungen werden und lief alles andere als konfliktfrei ab. Als 1951 das vierte Lohn-Preis-Abkommen ausgelaufen ist, wollten Bundeskanzler Julius Raab und Finanzminister Kamitz von der Politik der Preisregulierungen abgehen. Es war der ÖGB und die Arbeiterkammer, die unter Johann Böhm und Karl Maisel auf eine dauerhafte Institutionalisierung der sozialpartnerschaftlichen Lohn- und Preisdisziplin drängten. Zuerst konnte die Landwirtschaftskammer als Bündnispartner gewonnen werden. Als Raab 1957 der Errichtung der Paritätischen Kommission für Lohn- und Preisfragen zustimmte, gab es in der Wirtschaftskammer noch gewichtige Vorbehalte. Die Zustimmung wurde vorerst nur für ein Jahr erteilt, und die Umsetzung verlief holprig. Erst mit dem Raab-Olah Abkommen, das über Weihnachten 1961 ausgehandelt wurde und mit der Errichtung des Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen als Unterausschuss der Paritätischen Kommission kam es zur erfolgreichen Institutionalisierung der Globalsteuerung. Wesentlicher Grund für das Umdenken auf der Wirtschaftsseite war der massive Preisauftrieb ab 1960, das zunehmende Drängen der Expert:innen und das Scheitern alternativer inflationsdämpfender Versuche.[13]
Bündnispolitik und Verhandlungskunst
Wichtig für die schlussendliche Kompromissfindung war nicht zuletzt die überfraktionelle Herangehensweise des ÖGB und der Arbeiterkammer und eine aktive Bündnispolitik. So traten auch die Fraktion christlicher Gewerkschafter:innen und der ÖAAB als Arbeitnehmer:innenflügel der ÖVP für eine Mitbestimmung der Arbeitnehmer:innen in der Wirtschaftspolitik ein. Der ÖAAB nahm auf diese Weise immer wieder die Rolle eines Vermittlers zwischen Wirtschaftsbund und Sozialdemokratie ein.[14] Auch der Bauernbund war Markteingriffen weniger abgeneigt als die Unternehmer:innenvertreter und konnte immer wieder für gemeinsame wirtschaftspolitische Maßnahmen ins Boot geholt werden. Es ist interessant, dass sowohl in der Entstehung des New Deals, als auch des Schwedischen Modells die Bauernvertreter:innen trotz ihrer gesellschaftspolitisch sehr konservativen Anschauen eine Schlüsselrolle spielten[15]. Im Wirtschaftsbund gab es die stärksten Vorbehalte für ein Bündnis. Er konnte schlussendlich auf Basis konkreter praktischer Erfolge der Maßnahmen in der Kombination von niedriger Inflation, harter Währung, niedriger Arbeitslosigkeit und hohem Wirtschaftswachstum für eine nachhaltige Zusammenarbeit gewonnen werden. Die auf diese Art gebildete Wirtschaftspartnerschaft funktionierte schlussendlich auch für den Wirtschaftsbund in der Praxis so gut, dass sie 1967 ausgerechnet unter einer ÖVP Alleinregierung weiter vertieft wurde. Im Verbändekomitee wurde jetzt auch die Zusammenarbeit der Wirtschaftspartner mit der Nationalbank und dem WIFO institutionalisiert. Neben der Entwicklung einer faktenbasierten Diskussionskultur auf Exper:innenebene spielten bei der Kompromissfindung auch der Aufbau von Vertrauen, der gegenseitige Respekt und Handschlagqualität auf persönlicher Ebene eine große Rolle. Legendär geworden sind die persönlichen Achsen Julius Raab (ÖVP, Wirtschaftsbund) – Johann Böhm (ÖGB), Julius Raab – Franz Olah (ÖGB), Anton Benya (ÖGB) – Rudolf Sallinger (Wirtschaftskammer). In der Kompromissfindung lassen sich die Maximen des später entwickelten Harvard Konzepts entdecken:
- Trenne die Menschen von ihren Positionen
- Fokussiere auf Interessen und nicht auf Positionen
- Entwickle Entscheidungsoptionen, bei denen beide Seiten etwas gewinnen.
- Bestehe auf objektiven Beurteilungskriterien.
Eine weitere Maxime des Harvard Konzepts lautet: Sei dir bewusst, was deine nächstbesten Alternativen sind, falls die Verhandlungen scheitern. Auch diese Regel scheint befolgt worden zu sein. Österreich hatte zwar weit weniger Streikminuten als andere westeuropäische Länder, der ÖGB konnte aber, wenn es darauf ankam, durchaus seine Mobilisierungskraft unter Beweis stellen: 1962 legten rund 200.000 Metaller, die Arbeit für 4 Tage nieder und legten dar, dass eine Abkehr vom Verhandlungsweg für die Arbeitgeber durchaus mit hohen Kosten verbunden war. Wesentliche Voraussetzung für eine funktionierende Sozialpartnerschaft auf Augenhöhe war sicher auch die Stärke des ÖGB.
Mitbestimmungsgedanke und Identifikation mit dem neuen Österreich
Die Regierungserklärung vom 27. April 1945[16] hieß es:
„Verzagt nicht! Fasset wieder Mut! Schließt Euch zusammen zur Wiederaufrichtung Eures freien Gemeinwesens und zum Wiederaufbau Eurer Wirtschaft!“
Der Appell stieß auf fruchtbaren Boden. Der Wirtschaftshistoriker Felix Butschek schreibt, dass das „vorbehaltlose Bekenntnis zum österreichischen Staat und die Entschlossenheit, seine Wiederherstellung mit aller Kraft voranzutreiben“ neben der hohen Qualifikation der österreichischen Arbeitskräfte für den wirtschaftlichen Erfolg der Republik entscheidend waren.[17] So begannen beispielsweise bereits im Mai 1945 die Arbeiter:innen der zerbombten und von den deutschen Firmenleitungen verlassenen Industriebetriebe von sich aus und ohne Garantie über die Zukunft die Werke wieder aufzubauen. Wesentliche Voraussetzung für diese Entschlossenheit war, dass die Beteiligten anders als 1918 wirklich das Vertrauen hatten, dass es ihre Wirtschaft und ihre Republik war, die hier aufgebaut wurde. Ausschlaggebend dafür war die neue Praxis der Mitbestimmung, die über die Interessenvertretungen organisiert wurde und von Beginn an alle Ebenen des Wirtschaftslebens durchdrang. Diese Mitbestimmung begann mit den Betriebsrät:innen in den Betrieben und setzte sich auf gesamtwirtschaftlicher Ebene durch die Mitsprache der Gewerkschaften und Kammern in der makroökonomischen Globalsteuerung fort. Die Einbindung der Verbände in die Entscheidungen und das Erringen tragfähiger Kompromisse konnte das Vertrauen ihrer Mitglieder in den neuen Staat weiter steigern. Dies zeigte sich im Erstarken der Regierungsparteien SPÖ und ÖVP auf Kosten radikaler Strömungen. Der rechtsextreme FPÖ-Vorläufer VDU (Verband der Unabhängigen) konnte noch 1949 starke Wahlergebnisse erzielen (Wels 29 %, OÖ 20%). Die Stalintreue KPÖ erreichte rund 5 % der Stimmen. In den 50er und 60er Jahren büßte die KPÖ stark, die FPÖ deutlich an Rückhalt in der Wahlbevölkerung ein.
Progressiver Patriotismus
Und jetzt gelang etwas Unerwartetes: Obwohl das neue Österreich keine Großmacht mehr war, entstand ein authentischer Stolz der Menschen auf dieses kleine Land, eine authentische Identifikation. Stolz auf die Fähigkeit, aus eigener Kraft und ohne Rohstoffe eine eigene erfolgreiche Industrie und Landwirtschaft aufzubauen. Stolz auf die Mitsprache der arbeitenden Menschen in der Wirtschaft. Stolz auf die Demokratie und die Neutralität.
Später unter Bundeskanzler Bruno Kreisky kam mehr und mehr auch der Stolz auf ein kleines Land hinzu, das sich aktiv auf internationaler Ebene einbringt, um die Welt gerechter und friedlicher zu machen und das sich als Sitz der Vereinten Nationen für multilaterale Lösungen starkmacht.
Der sozialdemokratische schwedische Premierminister Per Albin Hansen entwickelte in den 1930er Jahren mit seinem Konzept des Volksheims die Vision, dass wirklicher Patriotismus nachhaltig nur dann entstehen könne, wenn die Masse der Arbeiter:innen in der Politik und auch im Wirtschaftsleben wirkliche Mitsprache erhielten. Erst dann könnten die Arbeiter:innen die Republik wirklich als ihre Heimat annehmen, erst dann würde die Republik zur Heimat aller Bewohner:innen, zur Volksheimat. Mit diesem Konzept schaffte es Per Albin Hansen, Schweden aus der politischen Polarisierung und Radikalisierung der 30er Jahre herauszuhalten und anders als in anderen Ländern ein Erstarken des Faschismus zu verhindern. Anders als im restlichen Europa begannen in Schweden auch die Frauen, sich stark ins politische Leben einzubringen, um für Gleichberechtigung zu kämpfen.
Es scheint, dass dieses Modell der Identifikation durch Mitsprache in der Nachkriegszeit auch in Österreich erste Wurzeln schlagen konnte. Freilich waren die 50er und 60er Jahre gerade in Hinblick auf die Situation von Frauen noch stark in patriarchalischen und konservativen Strukturen verhaftet. Hier brachten erst die Kreisky Jahre erste dringend nötige gesellschaftliche Liberalisierungsschritte. Aber ähnlich wie in Schweden entstanden Ansätze zu einem progressiven Patriotismus, der sich über die Werte Partizipation, Gleichberechtigung, faktenbasierter Dialog, Friede, soziale Gerechtigkeit, Demokratie, internationale Solidarität und Multilateralismus definiert. Unter Bundeskanzler Bruno Kreisky (1970 bis 1983) erreichte das Nachkriegsmodell seinen Zenit. Doch am Horizont begannen sich dunkle Wolken zusammenzuziehen.
Risse im Nachkriegsmodell
Mit der Ölkrise und der Stahlkrise schien die Industriestruktur der Nachkriegswirtschaft an das Ende ihrer Expansion zu kommen. Auch wenn Österreich besser durch die Krisen der 70er kam als andere westeuropäische Länder[18] und wesentliche Modernisierungsschritte im Wirtschaftsleben stattfanden, wurden nun erste Risse im Nachkriegsmodell sichtbar. Mit den Protesten gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf 1974 bis 1978 und der Besetzung der Hainburger Au 1984 zeigte sich, dass wesentliche neue Bedürfnisse der Bevölkerung zum Schutz der Umwelt von den Sozialpartnern zu wenig berücksichtigt wurden. Ähnliches galt auch für neue Bedürfnisse der Gleichberechtigung, der persönlichen Mitgestaltung und der individuellen Entwicklung. Viele – Frauen und junge Menschen im Besonderen – erlebten die Interessenvertretungen nicht als Instrument der Mitbestimmung und Mitgestaltung. Die Vision Bruno Kreiskys, alle Bereiche der Gesellschaft mit Demokratie zu durchfluten, konnte trotz wichtiger Meilensteine wie dem Arbeitsverfassungsgesetz 1974 oder der Reform des Eherechtes Anfang der 80er Jahre nicht weiter vertieft werden.
In der Bewältigung der ökonomischen Strukturkrise der 70er Jahre gelang es den Sozialpartnern nicht mehr, nachhaltig tragfähige Kompromisse zu finden. Der Versuch, die Stahlindustrie zu modernisieren ohne Arbeitsplätze abzubauen, führte über einen abenteuerlichen Expansionskurs zu massiven Managementfehlern und Skandalen in der verstaatlichen Industrie (Intertrading, Noricum, VOEST Debakel) und zu einem Anstieg der Staatsschulden. Kompromisse erfolgten auf Kosten ausgeglichener Budgets. Bei Teilen der Bevölkerung entstand im Zuge von Diskussionen über die Sozialleistungen in verstaatlichten Bereichen der Eindruck, dass nicht mehr das gesellschaftliche Ganze im Vordergrund stünde, sondern Partikularinteressen. Vor diesem Hintergrund bereiteten sich auf Weltebene institutionelle Umbrüche vor, die die Machtverhältnisse von den Arbeitnehmer:innen zu den Arbeitgeber:innen verschoben.
Trendumkehr
Bereits der Zusammenbruch des Bretton Woods Systems 1971 stärkte mittelfristig den Einfluss der Finanzmärkte auf wirtschaftspolitische Entscheidungen. Gleichzeitig zeichnete sich von den USA und Großbritannien herkommend ein wirtschaftspolitischer Paradigmenwechsel ab, der auf einen Rückzug des Staates und auch der Interessensverbände der Arbeitnehmer:innen aus wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen setzte und damit eine tragende Säule des Modells zweite Republik infrage stellte. Zwar wurden weiterhin große gemeinsame Projekte sozialpartnerschaftlich bewältigt: die Umstrukturierung, Modernisierung und Teilprivatisierung der ehemaligen verstaatlichen Industrie 1986 bis 1999, der EU-Beitritt oder die Budgetkonsolidierung und Stabilisierung des Finanzsektors nach der Finanzkrise 2008. Auf der Ebene der Kollektivverträge und auf betrieblicher Ebene konnte die Sozialpartnerschaft weiter wichtige Erfolge erreichen. Aber in der makroökonomischen Globalsteuerung der Wirtschaft setzte Mitte der 80er Jahre eine deutliche Wende ein. Ab 1986 erfolgte nicht nur ein schrittweiser Rückzug des Staates aus einer direkten Leitungsfunktion in Industrie und Bankenwesen. Es setzte sich mehr und mehr auch die wirtschaftspolitische Sichtweise durch, dass es auch keiner wirtschaftlichen Globalsteuerung und letztlich auch keiner Industriepolitik mehr bedürfe. Damit versanken die sozialpartnerschaftlichen Einrichtungen der makroökonomischen Steuerung wie die Paritätische Kommission, das Verbändekomitee oder die Wirtschaftliche Aussprache mehr und mehr in der Bedeutungslosigkeit.
Der Verlust des Gemeinsamen
Da mit dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989 eine Ära niedriger Inflation und freien Handels begann, waren die Rahmenbedingungen nun völlig andere als in der Nachkriegszeit: Es gab keine Inflationsgefahr, keine Lieferkettenprobleme. Im Unterschied zur Nachkriegszeit gab es jetzt keine gemeinsame Vision von einer neuen Infrastruktur und neuen Schlüsselindustrien, die es auszubauen galt. Österreichs erfolgreiche mittelständische Industriebetriebe, die lange Zeit von den Exportkontakten und den billigen Vorprodukten der verstaatlichten Industrie aber auch von günstigen und langfristigen Krediten der öffentlichen Banken profitierten, schienen – einmal etabliert – den Staat nicht mehr zu benötigen, um an den Weltmärkten zu reüssieren. Die Wirtschaftskraft wuchs weiter. Nichtsdestotrotz blieb der Abbau der gesamtwirtschaftlichen Steuerung nicht folgenlos. Das Ziel der Vollbeschäftigung wurde aufgegeben, die Ungleichheit stieg an. Es gelang keine Einigung auf neue gemeinsame Ziele der wirtschaftlichen Entwicklung, wie etwa eine ökologische Transformation der Wirtschaft oder ein menschengerechteres Wirtschaftsleben. Auch in der Migrationspolitik ging die sozialpartnerschaftliche Koordination und Steuerung verloren, die es beispielsweise in den 1960ern gab (Raab-Olah Abkommen). Der wesentliche Effekt dieser nachlassenden gemeinsamen gesamtwirtschaftlichen Steuerung war, dass ab Mitte der 80er Jahre der soziale Zusammenhalt langsam zu bröckeln begann. Ein immer größerer Teil der Bevölkerung, vor allem der Arbeiter:innen hatte immer weniger das Gefühl, dass es ihre Wirtschaft und ihre Republik war, um die es jetzt ging. Das Grundversprechen der zweiten Republik verblasste. Die weitere Folge war: zurückgehendes Vertrauen in die Politik und die politischen Parteien überhaupt, steigende Polarisierung und schlussendlich der Aufstieg einer politischen Kraft, die den institutionellen Rahmen der zweiten Republik direkt infrage stellte.
Aufstieg der FPÖ und der Schwenk zu Schwarz-Blau
Der Aufstieg der FPÖ unter Jörg Haider erfolgte komplementär zum zunehmenden Rückgang der Mitbestimmungsmechanismen und begann eben im Krisenjahr der Verstaatlichten 1986. Die FPÖ präsentierte mit ihrer Forderung nach der dritten Republik bereits in den 90er Jahren eine direkte Antithese zur Zweiten Republik mit den Charakteristiken: Abbau der Sozialpartnerschaft und ihrer Institutionen (z.B.: Kammern), Zuschneiden der Exekutive auf eine Person, Ausbau der direkten Demokratie.[19] Mit Herbert Kickls offener Orientierung an Orban und Trump, dem Reden von Fahndungslisten und NS-Begriffen wie Volkskanzler zeigt dieses Gegenmodell, dass es mit einer liberalen Demokratie nur noch wenig gemein hat.
Eine weitere Erosion des Nachkriegsgefüges setzte mit den ÖVP-FPÖ-Koalitionen 2000 und 2017 ein. Mit der Sichtweise, dass es zwischen der ÖVP und einer FPÖ der dritten Republik mehr Gemeinsamkeiten gäbe als zwischen ÖVP und SPÖ, ist die zweite Republik an einem gefährlichen Scheideweg angelangt.[20] Denn es wurde nun nicht mehr nur eine tragende Säule, sondern das Fundament der Zweiten Republik infrage gestellt: Die strategische Zusammenarbeit von Arbeitnehmer:innen- und Arbeitgeber:innenverbänden.
Kann es für die Zweite Republik ein Revival geben?
Die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die wir heute vorfinden – Preisauftrieb, Lieferkettenschwierigkeiten, Krieg in Europa, Rückkehr des Protektionismus, bedrohlicher Aufstieg des Rechtsextremismus, haben sich gegenüber den 1990er Jahren grundlegend verändert. Es werden heute ähnliche Fragen aufgeworfen wie 1945: Wie sichern wir die Energieversorgung unserer Haushalte und welche Infrastruktur brauchen wir dazu? Wie transformieren wir die Industrie, um auf den Märkten der Zukunft bei veränderter Technologie bestehen zu können? Wie schaffen wir gleichzeitig einen neuen sozialen Zusammenhalt? Wie stabilisieren wir unsere Republik? Viele dieser Fragen stellen sich heute auch auf europäischer Ebene und können nur dort gemeinsam beantwortet werden: Wie kann ein ökonomischer und politischer Raum formiert werden, der technologisch gegenüber den USA und China bestehen, der seine eigene Energieversorgung sichern und sich militärisch ohne Hilfe der USA schützen kann? All diese Fragen verlangen nach passenden industriepolitischen Maßnahmen, nach wirtschaftspolitischer Koordination und makroökonomischer Steuerung.
1945 ging es darum, eine gesamte Wirtschaftsstruktur auf- und umzubauen. Aber geht es heute wirklich um weniger? Manche Expert:innen vergleichen die durch die Erderhitzung notwendig gewordenen Veränderungen im Wirtschaftsleben mit der industriellen Revolution.[21] Auch die Veränderung der geopolitischen Lage und die damit verbundenen wirtschaftlichen Verwerfungen erfordern entschiedene Maßnahmen. Die Herausforderungen, vor denen wir ökonomisch stehen, sind heute ähnlich groß wie 1945 oder sogar größer.
In dieser Anordnung liegt das Potenzial einer neuen strategischen Allianz zwischen Arbeitnehmer:innen- und Arbeitgeber:innenverbänden zur Sicherung der Demokratie, des sozialen Zusammenhaltes, eines erfolgreichen Wirtschaftsraumes, aber auch zur Bewältigung der ökologischen Transformation. Die Erfolgsgeschichte könnte ein neues Kapitel aufschlagen – in Österreich und in Europa.
[1] Regierungserklärung Nr.3 vom 27. April 1945 im Namen der provisorischen Staatsregierung.
[2] Vergleiche dazu: Butschek, Felix: Vom Staatsvertrag zur EU – Österreichische Wirtschaftsgeschichte von 1955 bis zur Gegenwart, Wien – Köln – Weimar, 2004
[3] Eichengreen, Barry: ´Institutions and Economic Growth: Europe after World War II´ in Economic Growth in Crafts N., Toniolo G. (Hrsg): Europe since 1945, Cambridge, 1996
[4] Zur Herausbildung der Globalsteuerung in Österreich siehe: Dirninger, Christian: Austrokeynesianismus, zur wirtschaftspolitischen Rolle des Staates, Wien-Köln Weimar 2017, ab Seite 42
[5] Vergleiche Butschek, Felix: Vom Staatsvertrag zur EU – Österreichische Wirtschaftsgeschichte von 1955 bis zur Gegenwart, Wien – Köln – Weimar, 2004
[6] Dort hieß es etwa: „Wir verwerfen den westlichen demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat!… Jeder Kamerad fühle und bekenne sich als Träger der neuen deutschen Staatsgesinnung, er sei bereit Gut und Blut einzusetzen, er kenne drei Gewalten: den Gottglauben, seinen eigenen harten Willen und das Wort seiner Führer.“
[7] Vergleiche auch Mommsen, Hans: Alternative zu Hitler, München, 2000
[8] Schärf, Adolf: Österreichs Erneuerung 1945 – 1955, Wien, 1955 S 19 ff
[9] Vergleiche Östberg, Kjiell: The Rise and Fall of the Swedish Social Democracy, London, 2024
[10] Man denke etwa an die Ausschaltung des Parlaments durch die Christlich Soziale Partei in Österreich 1933, oder die Zustimmung sämtlicher bürgerlicher Parteien zu Hitlers Notverordnungen in Deutschland 1933. Andere Beispiele sind die Zustimmung der überwältigenden Mehrheit der bürgerlichen Abgeordneten zur Errichtung der Petein Diktatur in Frankreich 1940, die Unterstützung der konservativen Parteien für die Mussolini Diktatur in Italien.
[11] Kreisky, Bruno: Zwischen den Zeiten – Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten, Berlin, 1986
[12] Siehe Butschek, Felix: Vom Staatsvertrag zur EU – Österreichische Wirtschaftsgeschichte von 1955 bis zur Gegenwart, Wien – Köln – Weimar, 2004, Seite 63
[13] Siehe Pellar, Brigitte; Klenner Fritz: Die Österreichische Gewerkschaftsbewegung – von den Anfängen bis 1999, Wien, 1999 Seite 443 ff
[14] Vergleiche Reichhold Ludwig: Geschichte der christlichen Gewerkschaften Österreichs, Wien, 1987
[15] Die Schwedischen Sozialdemokraten regierten in den Anfangsjahren gemeinsam mit der Bauernpartei. Ohne die agrarisch geprägten, sehr konservativen Southern Democrats hätte Roosevelt keine Mehrheit für den New Deal zustande gebracht.
[16] Regierungserklärung Nr.3 vom 27. April 1945 im Namen der provisorischen Staatsregierung
[17] Siehe Butschek, Felix: Vom Staatsvertrag zur EU – Österreichische Wirtschaftsgeschichte von 1955 bis zur Gegenwart, Wien – Köln – Weimar, 2004, Seite 19
[18] Bei den Indikatoren, Inflation, Arbeitslosigkeit und Produktivitätszuwachs lag Österreich durchwegs über dem Durchschnitt der Industrieländer bzw. dem EG-Durchschnitt. Siehe Seidel, Hans: Wirtschaft und Wirtschaftspolitik in der Kreisky Ära. Wien, Köln, Weimar, 2017. Seite 14 u. Seite 50
Seidel bezeichnet die Wirtschaftspolitik der Kreisky Ära als im Ganzen gesehen erfolgreich, wenn auch makro- und mikroökonomische Ungleichgewichte hinterlassen wurden. (Ebenda, Seite 13)
[19] Siehe Minich, Oliver: Die Freiheitliche Partei Österreichs als Oppositionspartei in der Ära Haider : Strategie, Programmatik, innere Struktur. in Malstätter Beiträge aus Gesellschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur: 2003. S. 48
[20] Eine blaue Regierungsbeteiligung gab es bereits davor unter SPÖ Kanzler Fred Sinowatz 1983. Damals wurden aber die Institutionen der Sozialpartnerschaft vollumfänglich beibehalten. Die FPÖ verfolgte 1983 anders als nach 1986 nicht das Ziel, den Institutionenrahmen der zweiten Republik bzw. Europas offen herauszufordern. Sie befürwortete damals beispielsweise einen EU Beitritt.
[21] Wissenschaftlicher Beirat der deutschen Bundesregierung Globale Umweltveränderungen: Welt im Wandel, Gesellschaftsvertrag für ein große Transformation, Hauptgutachten, Berlin, 2011, zitiert bei Soder, Michael: Die Gründe Revolution, Wien, 2024, S 3