Nina P. ist 22 und schließt bald ihre Lehre bei der Stadt Wien ab. Sie weiß, was Kinderarmut bedeutet – denn sie hat sie selbst durchlebt. Sie erzählt, wie es ist, wenn man nicht auf Schulausflüge und die Geburtstagsfeier der Freundin gehen kann. Welche Erklärungen man sich als Kind zurechtlegt. Und welche Strategien die Familie entwickelt, um den Alltag zu meistern.
Kontrast.at: Nina, wie würdest du Kinderarmut erklären – wo fängt die an?
Nina P.: Meiner Meinung nach beginnt Kinderarmut dort, wo Eltern arm sind. Wenn sie als Erwachsene zu wenig zum Leben haben, haben auch die Kinder zu wenig. Denn es sind ja die Eltern, die die Kinder versorgen. Haben Eltern nichts, haben die Kinder nichts.
Wie trifft Armut denn Kinder im Speziellen?
Nina P.: Bei Kindern ist es ja ein starker Einschnitt ihrer Entwicklung. Es hemmt sie, weil sie bei vielem nicht mitmachen können. Da geht’s zum Beispiel um Schulausflüge, um das Eis nach der Schule, das nicht drin ist. Oder den Kinofilm, den die anderen sehen können und du nicht. Oder du kannst nicht auf die Geburtstagsfeier der Freundin gehen – weil ohne Geschenk kannst du dort nicht aufkreuzen. Und all das nur weil das Geld fehlt. Als Kind fühlt man sich einfach ausgeschlossen. Als Erwachsener kann man sich das noch eher erklären und damit umgehen, warum man verzichten muss. Aber als Kind versteht man das nicht.
Ich habe es ja auch nicht verstanden. Meine Eltern haben versucht, mir zu erklären, warum manches nicht geht. Für mich war es dennoch schwierig. Ich hab nicht verstanden, warum ich keine „Milchschnitte“ haben kann. Oder warum andere Kinder „Überraschungseier“ bekommen, ich aber nicht.
Wie sind deine Eltern damit umgegangen? Wie haben sie dir erklärt, warum du keine Süßigkeiten haben kannst?
Nina P.: Als Kind denkt man sich, die Mama ist gemein, wenn sie einem die Milchschnitte nicht kauft.
Mama hat versucht, mir zu erklären, dass wir diesen einen Euro jetzt eben nicht für meine Schnitten ausgeben können, weil wir ihn fürs Brot zum Frühstück für alle brauchen.
Sie hat erklärt, dass wir uns das nicht leisten können. Aber als Kind kannst du nicht verstehen, warum das Geld bei euch fehlt und bei anderen nicht.
Wann war bei dir der Punkt, an dem du gemerkt hast: Etwas ist anders als bei anderen Familien?
Nina P.: Das war schon in der Volksschule, mit 6 oder 7 Jahren. Da hat das mit den Schulausflügen angefangen – und die gingen nicht immer. Ich habe 3 Geschwister. Das sind Drillinge und sie sind knapp zwei Jahre älter als ich. Und die waren ja auch in der Schule, haben Schulsachen gebraucht und sollten auch auf Ausflüge. Und das Geld für vier Kinder, die zeitgleich Ausflüge machen, das war nicht da. Meine Mama hat allein das Geld aufbringen müssen für fünf Personen. Und da konnte ich also nicht immer mit. Da habe ich gemerkt, dass es bei uns anders ist.
Wenn ich fragen darf: Was waren bei euch die Gründe, dass es finanziell knapp war?
Nina P.: Es waren mehrere Sachen auf einmal. Früher waren meine Mama und mein Papa berufstätig. Vor zehn Jahren ca. ist dann mein Vater ausgezogen. Es gab nur ein Einkommen, nämlich das meiner Mama. Und ein Einkommen für fünf Leute – das ist sehr schwer. Meine Mama macht Fahrtendienste, also z.B. Krankentransporte, und verdient ca. 1.100 Euro im Monat. Das für einen Erwachsenen und vier Kinder ist fast nicht schaffbar. Man muss auch erstmal eine Wohnung finden, die für fünf Menschen groß genug ist und die man sich dennoch leisten kann. Darum war bei uns einfach Geld immer Mangelware.
Hast du dich als „arm“ definiert als du ein Kind warst? War das ein Begriff für dich?
Nina P.: Nein, bevor ich 10 war, hab ich das so nicht gesehen. Jetzt, wo ich zurückschaue, sehe ich das anders.
Klar, wir waren arm. Aber als Kind habe ich das nicht so gesehen. Zum einen war es für mich einfach normal, dass wir wenig Geld hatten und nicht alles bekommen haben, was wir wollten. Zum anderen war „arm“ ein Begriff, der negativ behaftet ist. Den möchte man nicht für sich verwenden.
Aber wie gesagt, heute sehe ich das anders. Da verwende ich den Begriff schon, um die Situation damals zu beschreiben.
Wann ist dir zum ersten Mal bewusst geworden, dass der Begriff „arm“ auf deine Familie zutrifft?
Nina P.: Das war in der Unterstufe im Gymnasium. In Geographie haben wir über das Thema Armut geredet und durchgerechnet, ab wann man in Österreich als „arm“ oder „armutsgefährdet“ gilt. Und da habe ich mir das für unsere Familie angeschaut. Als ich gesehen habe, welche Summe da pro Kopf bei uns stand, hab ich gesehen, dass wir weit unter der Schwelle gelegen sind. Da habe ich verstanden: Wir sind also arm. Das war das erste Mal, dass ich mich bewusst mit diesem Begriff auseinandergesetzt und identifiziert habe.
Kinderarmut in Österreich |
|
War das dann bei euch zu Hause ein Thema, über das ihr gesprochen habt?
Nina P.: Nein. Zu Hause darüber geredet habe ich nicht. Wie gesagt, ich war die Situation selbst ja gewohnt. Es war für mich nichts besonderes, arm zu sein. Es war einfach mein Alltag. Ich kannte es nicht anders. Deshalb hatte ich auch kein großes Bedürfnis, darüber zu reden.
Wie ging es dir mit alldem als du älter geworden bist?
Nina P.: Im Gymnasium war es dann noch schwieriger. Da standen dann ja die großen Reisen an. Einwöchige Sprachreisen, Skikurse und dergleichen. Wir haben das dann so gehalten, dass wir Kinder uns abgewechselt haben. Wenn meine Schwester eine Woche mit der Klasse wohin gefahren ist, konnten in dem Jahr wir anderen halt nicht. Das war der Kompromiss. Aber das war in Ordnung. In dem Alter habe ich das schon besser verstanden, warum das Geld nicht da ist.
Wie erklärt man in der Schule, dass man nicht mitmachen kann?
Nina P.: Am Anfang hab ich eher Ausreden gesucht und drumherum geredet, warum es nicht geht. Vor allem, wenn die Freunde und Freundinnen gefragt haben, warum ich nicht mitfahren kann. Es war halt immer etwas unangenehm. Man schämt sich ja, vor allem, wenn man jünger ist. Da geht’s ja auch immer auch um die Frage, wer die neuesten Sachen hat. Später, in der Oberstufe im Gymnasium, ist es mir dann leichter gefallen, zu sagen, warum ich z.B. nicht nach Frankreich mitfahren kann. Da hab ich einfach gesagt: „Wir können uns das nicht leisten, weil meine Schwester fährt heuer mit ihrer Klasse schon wo hin.“ Da war schon mehr Selbstvertrauen da. Aber klar, es hat sich dann dennoch nicht gut angefühlt als alle zurückgekommen sind und erzählt haben, wie es war. Da weiß man natürlich, man hat etwas verpasst. Aber das Schamgefühl war da insgesamt schon weg. Ich konnte offener darüber reden.
Wie haben deine MitschülerInnen reagiert, wenn du gesagt hast, du kannst nicht mitfahren? Haben sie das verstanden?
Nina P.: Es kam stark darauf an, ob ich die einzige war, die nicht mitgefahren ist oder ob es mehrere waren. Denn bei einem Ausflug gibt es ja eine Mindestzahl an TeilnehmerInnen, damit etwas stattfinden kann. Zum Beispiel 16 von 20 SchülerInnen oder so. Wenn ich die einzige war, die nicht mitgefahren ist, war es egal. Da war der Ausflug als solcher ja nicht gefährdet. Aber wenn mehrere nicht können – und man selbst ist die letzte Person, die absagt, dann ist es schwierig. Dann ist man der Buhmann. Weil man es quasi allen versaut. Ich kann mich erinnern, es war in der 2. Klasse im Gymnasium, da hätte unsere Klasse drei Tage am Bauernhof verbringen sollen. Diese drei Tage hätten 100 Euro gekostet. Und die konnten wir einfach nicht auftreiben. Meine Mama hat gesagt, „Bitte sag in der Schule, du kannst nicht.“ Also bin ich zur Lehrerin gegangen – und die hatte gar kein Verständnis.
Die Lehrerin meinte nur: „Dann fahren wir alle nicht“ und „Wie kann das sein, 100 Euro wird man ja wohl auftreiben können!“ Das war mir sehr unangenehm. Da habe ich mich auch geschämt.
Später ist mir das dann leichter gefallen. Da hab ich sowas einfach nicht mehr an mich herankommen lassen. Aber diese Lehrerin damals… die war echt unsensibel.
Du machst ja aktuell eine Lehre und gehst auf die Berufsschule. Und du machst die Matura. Wie ist es zum Wechsel vom Gymnasium in die Lehre gekommen?
Nina P.: Bei mir war es so: Ich war an sich immer eine gute Schülerin. Aber am Gymnasium hatte ich dann irgendwann meine Schwierigkeiten in Französisch, Latein und Mathe. Ich hätte da echt Nachhilfe gebraucht, aber das Geld dafür war nicht da. Ich hatte zwar Freundinnen, die mir geholfen hätten, aber mir war das dann auch zu unangenehm, um Hilfe zu fragen und nichts als Gegenleistung anzubieten. Letzten Endes habe ich die 7. Klasse nicht geschafft – auch ein zweites Mal nicht. Dann war der Punkt, an dem ich beschlossen habe, dass es nicht funktioniert.
Und dann habe ich überlegt, eine Lehre zu machen. Das hat Überwindung gekostet. Weil ja Leute oft auch denken: „Eine Lehre? Das ist was für Dumme!“ Aber es war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Ich bin selbstständig, verdiene mein eigenes Geld, für die Familie ist es eine finanzielle Entlastung. Und ich lerne etwas, mit dem ich später arbeiten kann. Meine Mama hat mich auf diesem Weg sehr unterstützt und mich in Richtung Lehre gepusht. Und jetzt bin ich Verwaltungsassistentin bei der Stadt Wien, mittlerweile im 3. Lehrjahr. Und ich mach die Matura nach, weil vielleicht will ich ja mal hoch hinaus und dann bin ich flexibel (lacht).
Du hast in deiner ausgezeichneten Rede gesagt, du wünscht dir ein Bildungssystem, wo alle Kinder an derselben Startlinie beginnen können. Was denkst du, was würde dabei helfen?
Nina P.: Ich finde, eine Grundausstattung für die Schule wäre wichtig. So eine Art Starter-Paket mit Heften, Stiften, Dreiecken und dergleichen. Bei uns war es so – wie wohl bei allen – dass der Schulstart jedes Jahr sehr, sehr teuer war. Stifte, Geodreiecke, Zirkel, Bücher fürs Schuljahr. Bei vier Kindern hat das mehrere hundert Euro gekostet und da musste meine Mama schon Monate vorher zu sparen beginnen. Und trotzdem war es dann so, dass man dann seine eigenen Sachen mit dem der Sitznachbarin vergleicht. Wenn die die Stabilo-Stifte hat und du hast ganz billige… dann fühlt sich das nicht gut an.
Wenn alle eine gleiche Grundausstattung in der Schule hätten, gäbe es weniger sichtbaren Unterschied zwischen Arm und Reich. Das wäre schön. Dann gäbe es auch keinen Neid und keine Scham mehr.
Nina P. |
| Nina P. ist 22 und absolviert ihre Lehre zur Verwaltungsassistentin bei der Stadt Wien. Darüber hinaus macht sie auch ihre Matura nach. Sie ist mit drei Geschwistern in Wien aufgewachsen. Das Einkommen der Mutter musste für fünf Personen reichen. Geld war also immer knapp. Beim Jugend-Redewettbewerb 2018 macht sie ihre Erfahrungen mit Armut zum Thema und kritisiert, dass in Österreich Bildungs- und Lebenschancen noch immer vom Geldbörsel der Eltern abhängen. Mit ihrer Rede hat sie den 3. Platz gewonnen. |





































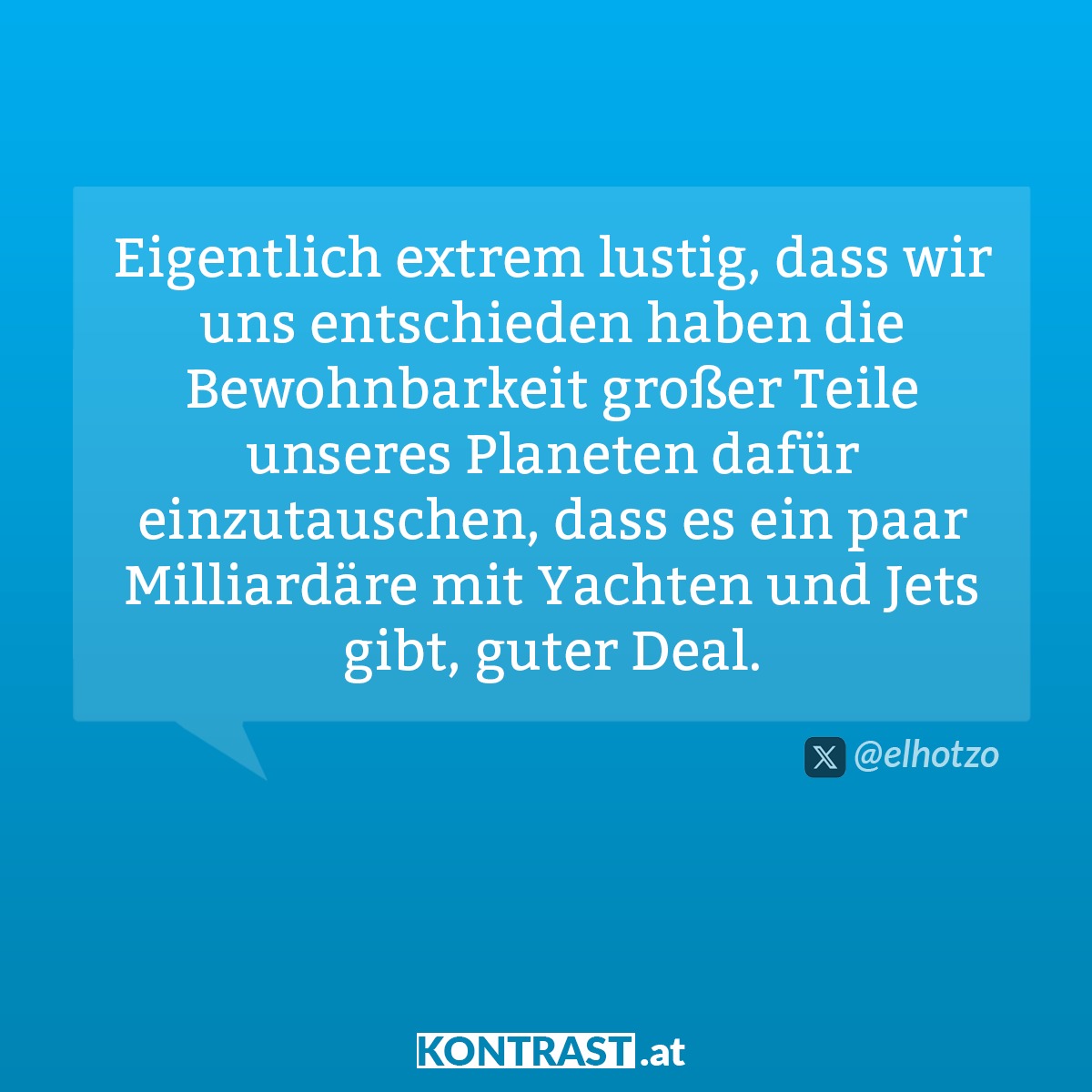





Lt. der Definition bin auch ich, genauso wie die meisten Kinder meiner Klassenkollegen resp. Generation, in Kinderarmut aufgewachsen.