Stiftungen hatten ursprünglich einen gemeinnützigen Zweck, etwa in den Bereichen Soziales, Bildung oder Kultur. Doch heute sind sie auch ein beliebtes Werkzeug, um Vermögen zu sichern und Steuern zu umgehen. In Österreich boomen vor allem eigennützige Privatstiftungen – über 80 % dienen hauptsächlich dem Schutz privater Vermögen. Der Fall René Benko zeigt, wie schwer es ist, an Milliardenwerte in Stiftungshand heranzukommen – selbst bei Insolvenzen. Wir erklären, wie Stiftungen genau funktionieren, welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten, wo die Grenze zwischen Gemeinwohl und persönlichem Vorteil verläuft und warum die österreichische Regierung die Stiftungssteuern erhöhen will.
Stiftungen einfach erklärt
Stiftungen verfolgen gemeinschaftlichen Zweck
Eine Stiftung ist eine wirtschaftlich-rechtliche Struktur, die mit einem bestimmten Vermögen ausgestattet wird, um dauerhaft einen festgelegten Zweck zu verfolgen. Der Zweck kann eigennützig sein oder auch gemeinnützig, kulturell, wissenschaftlich oder sozial. Die Stiftung wird von einer Person, einer Gruppe oder einer Firma – die Stifter:innen – gegründet, indem Sachwerte, Geld oder anderes Vermögen an die Stiftung übertragen werden. Das Vermögen kommt also vom Stifter, der auch den Zweck derselben festlegt.
Anders als Unternehmen verfolgt eine Stiftung dabei nicht primär das Ziel, Gewinne zu machen – und sie gehört auch keinem einzelnen Menschen. Der Stifter ist zwar der Gründer, aber die Stiftung gehört sich selbst und besitzt ein eigenes Recht. Das unterscheidet sie auch von einer Gesellschaft oder einem Verein.
Das Geld im Topf bleibt unangetastet, nur die Erträge daraus werden verteilt
Man kann sich eine Stiftung wie einen Topf vorstellen, in dem sich Geld oder Vermögen befindet. Das Grundvermögen wird nicht angetastet, sondern angelegt – etwa auf einem Bankkonto, in Immobilien oder Wertpapieren. Nur die Erträge – also das, was der Topf „abwirft“, z. B. Zinsen, Mieteinnahmen oder Dividenden – werden verteilt. Das wird genutzt, um Projekte und Initiativen zu unterstützen.
“Die Idee ist relativ einfach: Es ist ein Kapital erforderlich, das selbst nicht verbraucht wird und von dem nur die Zinsen für einen dauerhaften Zweck zur Verfügung gestellt werden”, sagt Historiker Michael Borgolte.
Dadurch kann eine Stiftung über viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte bestehen und Jahr für Jahr ihren Zweck verfolgen, ohne dass das Grundkapital angetastet wird. Bei einer Privatstiftung werden die Erträge an die Begünstigten bzw. “Destinäre” vergeben. Oft handelt es sich dabei um die sichere Weitergabe von Vermögen innerhalb der Familie.
In Österreich ist mittlerweile weit mehr Vermögen in Privatstiftungen gebunkert, als die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung besitzt.

Stiftungsstruktur in Österreich
Viele unterschiedliche Stiftungen: Vom Kulturbereich bis zum Privatinteresse
Stiftungen in Österreich sind rechtlich vielseitig nutzbar – sie reichen von echter Gemeinnützigkeit, etwa im Bildungs-, Sozial- oder Kulturbereich (beispielsweise das Leopold Museum in Wien oder die Österreichische Ludwig Stiftung), bis hin zu eigennützigen Konstruktionen, die vor allem dem Schutz und der Steuerung großer Privatvermögen dienen. Gemeinnützige Stiftungen verfolgen dabei einen klaren gesellschaftlichen Zweck und agieren meist transparent. Sie sollen dem Allgemeinwohl dienen, sei es durch Förderung von Kunst, Wissenschaft, Bildung oder sozialen Projekten. Demgegenüber stehen viele Privatstiftungen, die oft von vermögenden Einzelpersonen oder Familien gegründet werden. Ihr Ziel ist es häufig, Vermögen generationenübergreifend zu sichern, Steuern zu entgehen oder Einfluss über wirtschaftliche Beteiligungen zu bündeln – und das unter weitgehender Diskretion. Der Fall René Benko zeigt, wie mithilfe solcher Stiftungen selbst in einer groß angelegten Unternehmensinsolvenz privater Reichtum vor dem Zugriff von Gläubigern geschützt werden kann.
Verschiedene gesetzliche Regelungen und besondere Stiftungen
Es gibt in Österreich auch verschiedene gesetzliche Regelungen für Stiftungen. Zum einen existieren Stiftungen, die nach dem Privatstiftungsgesetz (PSG) gegründet werden, zum anderen nach dem Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz (BStFG) sowie den Landes-Stiftungs- und Fondsgesetzen (LStFG) in neun Bundesländern.
Außerdem gibt es spezielle gesetzliche Regelungen für besondere Stiftungen. Ein Beispiel dafür ist die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung (FTE), die eine staatliche, gemeinnützige Stiftung ist und auf dem FTE-Nationalstiftungsgesetz von 2003 basiert. 2017 wurde die Innovationsstiftung für Bildung (ISB) ins Leben gerufen, die auf dem Innovationsstiftung-Bildung-Gesetz basiert. Es gibt außerdem kirchliche Stiftungen, die sowohl im kirchlichen als auch im staatlichen Bereich tätig sind. Über kirchlichen Stiftungen sind jedoch kaum öffentliche Informationen verfügbar.
Besonders einflussreich ist wohl die „Katholischer Medien Verein Privatstiftung“. Sie ist nicht nur Mehrheitseigentümerin der Regionalzeitungen NÖN und BVZ, sondern ihr gehören auch 98,33 % der Styria Media Group und damit die Tageszeitungen „Die Presse“, die „Kleine Zeitung“ und die „Wienerin“, aber auch Anteile an Radiosendern und Online-Marktplätze wie willhaben.at. Laut Stiftungszweck fördert die Stiftung aus ihren Erträgen „christiliche Medienarbeit“, die unter anderem „dem Geist der katholischen Kirche und ihrer Lehre“ und dem „dem Dialog zwischen Glaube und Wissenschaft“ dient.
Gemeinnützige Stiftungen: Die Idee geht weit in die Geschichte zurück
Gemeinnützige Stiftungen sind darauf ausgerichtet, einen allgemeinnützigen Zweck langfristig zu erfüllen. Die Zwecke können sehr unterschiedlich sein, aber die beliebtesten Bereiche sind Soziale Dienste, Bildung & Forschung, Kultur, Sport & Erholung sowie Gesundheitswesen.
Vor ihrer Gründung muss die gemeinnützige Stiftung behördlich geprüft werden. Es kann mehrere Monate dauern, bis sie vollständig anerkannt und registriert ist. In Österreich gibt es momentan 767 Stiftungen, die als rein gemeinnützig anzusehen sind.
Die Idee des Stiftens entstand unabhängig voneinander an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten auf der Welt. Eine der ersten Stiftungsformen reicht weit zurück – bis ins Alte Ägypten und nach Mesopotamien zu Beginn des dritten vorchristlichen Jahrtausends. Diese frühen Formen von Stiftungen waren oft Göttern und Ahnen gewidmet. Die Grundidee war dabei immer: Am besten sorge ich für mich selbst, wenn ich auch für andere sorge. Und das weit über meinen eigenen Tod hinaus.
Stiften braucht eine Wirtschaftsform, die mehr produziert, als verbraucht wird – sodass ein Rest übrig bleibt. Das ist seit der Landwirtschaftlichen Revolution im zweiten Jahrtausend vor unserer Zeit möglich. Eine weitere Voraussetzung ist, dass es nicht nur staatliches, sondern auch privates Eigentum gibt. In der westlichen Kultur ist das Kloster eine typische Form der Stiftung. Menschen stifteten Klöster (stellten also ihr Land und Geld zum Bau zur Verfügung), damit dort Mönche oder Nonnen versorgt wurden, die im Gegenzug für das Seelenheil der Verstorbenen beteten. Viele Klöster unterhielten außerdem Krankenhäuser oder Schulen, in denen Patient:innen oder Schüler:innen ebenfalls für die Verstorbenen beten sollten.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts blühte die gemeinnützige Stiftungslandschaft in Österreich. Das wurde sehr schnell durch die Weltwirtschaftskrise in den 1920er Jahren sowie später durch die Nationalsozialisten zerschlagen. Vor 1938 gab es rund 5.700 Stiftungen in Österreich. Davon wurden 2.400 Stiftungen aufgelöst, zerstört oder enteignet. Somit ging ein Großteil wohlwollender Kultur verloren und konnte nicht wiederhergestellt werden.
Privatstiftungen: Dort liegt das Vermögen der Superreichen
Privatstiftungsgesetz 1993: Der Boom an eigennützigen Privatstiftungen
In den 1990er Jahren setzten viele europäische Länder auf den Wiederaufbau gemeinnütziger Stiftungen. Österreich führte 1993 hingegen das Privatstiftungsgesetz (PSG) ein. Damit wurde eine Rechtsform eingeführt, die vor allem privates Vermögen in Familien und Unternehmen schützen sollte. Stiftungen mussten ab sofort nicht mehr auf Gemeinnützigkeit und Mildtätigkeit beschränkt sein, sondern lediglich einen legalen Zweck verfolgen. Der Grundgedanke der Privatstiftung war, mit einem “eigentümerlosen” Vermögen einen bestimmten Zweck besser verfolgen zu können, unabhängig vom Schicksal der Stifter:innen und Rechtsnachfolger:innen. Außerdem wollte man dadurch ausländische Investor:innen nach Österreich locken.
Über 80 % der Privatstiftungen in Österreich sind eigennützig
Diese liberale Gesetzgebung legte den Grundstein für rein privatnützige (Familien-)Stiftungen. Über 4.000 Privatstiftungen wurden seither gegründet, von denen heute noch etwa 3.143 bestehen. Seitdem wird das Privatstiftungsmodell auch für gemeinnützige Zwecke genutzt. Auf Basis der Zwecke, die im Firmenbuch ausgewiesen sind, können 2.628 als rein eigennützig klassifiziert werden.
Die restlichen Privatstiftungen sind entweder gemeinnützig oder gemischtnützig. Es ist teilweise undurchsichtig, ob eine Stiftung einen gemeinnützigen Zweck verfolgt oder nur einigen wenigen Personen Vorteile bringt. Aber im Gegensatz zur gemeinnützigen Stiftung werden Privatstiftungen oft von Einzelpersonen oder einer Familie gegründet und verfolgen vordergründig private Zwecke. Zum Beispiel die Verwaltung und Sicherung des Familienvermögens.
Privatstiftungen in Österreich bieten rechtliche und steuerliche Vorteile, womit sie zugleich Räume für potenziellen Betrug schaffen. Weil Stiftungen oft diskret arbeiten und die wahren Begünstigten nicht immer offengelegt werden müssen, kann Vermögen unter Umständen versteckt oder verschoben werden.
Insgesamt wird das Vermögen in Privatstiftungen von der Österreichischen Nationalbank (OeNB) für das Jahr 2022 mit rund 88 Milliarden Euro angegeben. Davon sind rund 54 Milliarden Euro Unternehmensbeteiligungen und ein kleiner Teil andere Finanzanlagen. Rund 34 Milliarden Euro stecken in Immobilien. Zum Vergleich: 1995 waren erst ca. 3,5 Milliarden Euro in den österreichischen Privatstiftungen geparkt.
In jedem Fall ist das Gründen einer Privatstiftung für die meisten Menschen in Österreich kaum möglich. Denn alleine für die Stiftungserklärung braucht man stattliche 70.000 Euro – in bar oder in Form von Sachwerten.
Österreichische Superreiche führen Privatstiftungen
In Österreich nutzen zahlreiche vermögende Familien Privatstiftungen nicht nur zur Verwaltung ihres Reichtums, sondern auch zur strategischen Einflussnahme und Imagepflege. Die Familie Swarovski etwa betreibt die „Swarovski Foundation„, die öffentlichkeitswirksam kulturelle Projekte unterstützt – während gleichzeitig große Vermögenswerte abgesichert werden. Der verstorbene Red-Bull-Milliardär Dietrich Mateschitz gründete gleich mehrere Stiftungen, darunter die „Wings for Life Stiftung“ zur Rückenmarksforschung, die sein Sohn Mark heute weiterführt.

Diese Stiftungen verbinden Wohltätigkeit mit enormem Einfluss – steuerlich begünstigt und rechtlich abgeschirmt. Auch die Porsche/Piëch-Familie stützt sich auf dieses Modell, um ihre milliardenschweren Konzernbeteiligungen zu kontrollieren, nämlich die Privatstiftungen „Ferdinand Karl Alpha“ und „Ferdinand Karl Beta“. So werden durch privatnützige Stiftungen nicht nur soziale Projekte gefördert, sondern auch wirtschaftliche Macht langfristig zementiert – oftmals unter dem Deckmantel des Gemeinwohls.
René Benko und seine Stiftungen: Bündelung von Luxusimmobilien, Autos und Yachten
René Benko, Signa-Gründer und Immo-Tycoon, konnte sich und seiner Familie trotz Signa-Pleite, Insolvenz und somit zahlreichen Pfändungen noch lange ein luxuriöses Leben ermöglichen. Und genau das verdankte er der „Laura Privatstiftung“ und der liechtensteinischen „Ingbe Stiftung“. Hauptstifterin der „Ingbe Stiftung“ in Vaduz ist Benkos Mutter, er selbst ist Nebenstifter und seine Frau und Kinder die Begünstigten. Unantastbares Vermögen ist genügend vorhanden, da die Stiftungen begründet wurden, als Signa finanziell florierte. Die „Laura Privatstiftung“ wurde von Benko und seiner Mutter gegründet, die auch Begünstigte ist.
Bei einem Insolvenzverfahren ist es für Masseverwalter nur sehr schwer, Stiftungen zu knacken. Benkos Masseverwalter, Andreas Grabenweger, möchte an das Vermögen für Benkos Gläubiger kommen und unternimmt deshalb nochmals den Versuch, die „Laura Privatstiftung“ zu knacken. Nach einer Absage vom Innsbrucker Landesgericht wendet er sich jetzt ans Oberlandesgericht.
In der „Laura Privatstiftung“ von René Benko wurden im Sommer 2023 Vermögenswerte im Marktwert von etwa einer Milliarde Euro gebündelt. Dazu gehörten:
- Immobilien in Tirol (z. B. Benkos Villa in Igls, Mietzinshäuser in Innsbruck) im Wert von rund 139 Mio. Euro sowie Liegenschaften in Deutschland (z. B. Gebäude in Berlin, Leipzig, Dresden).
- Luxusimmobilien wie das “Chalet N” in Lech, eine riesige Wohnung im 1. Wiener Bezirk, Forstgüter in der Steiermark und Tirol sowie Villen am Gardasee.
- Beteiligungen wie eine 42-Prozent-Beteiligung an der Laura Holding (Wert: 212,8 Mio. Euro), die ihrerseits Beteiligungen an Premium-Immobilien hatte
- Luxusgüter: eine Yacht („Roma“, 27,5 Mio. Euro), ein Privatjet (17,6 Mio. Euro) und zwei Ferraris (5,3 Mio. Euro).
- Kunstsammlung im Wert von 33,7 Mio. Euro.
Privatstiftungen sollen zur Budgetsanierung beitragen
Die österreichische Bundesregierung plant im Zuge der Budgetsanierung neben einer Bankenabgabe und einem Energiekrisenbeitrag von Energiekonzernen auch höhere Steuern für Stiftungen. Konkret soll die „Gewinnsteuer für Privatstiftungen“ (Zwischensteuer) von 23 % auf 27,5% angehoben werden. Sie wurde im Zuge der Abschaffung der Erbschaftssteuer 2011 deutlich von 11,5 % auf 25 % erhöht und unter der ÖVP-Grünen-Regierung gemeinsam mit der Konzerngewinn-Steuersenkung (KöSt) wieder auf 23 % gesenkt.
Außerdem soll die Stiftungseingangssteuer von 2,5 % auf 3,5% steigen. Sie fällt an, wenn die Stiftung untentgeltliche Zuwendungen erhält – das gilt auch für Immobilien. Damit sollen auch die Superreichen einen Beitrag leisten, das Milliardenloch im Budget der Vorgängerregierung zu sanieren.





























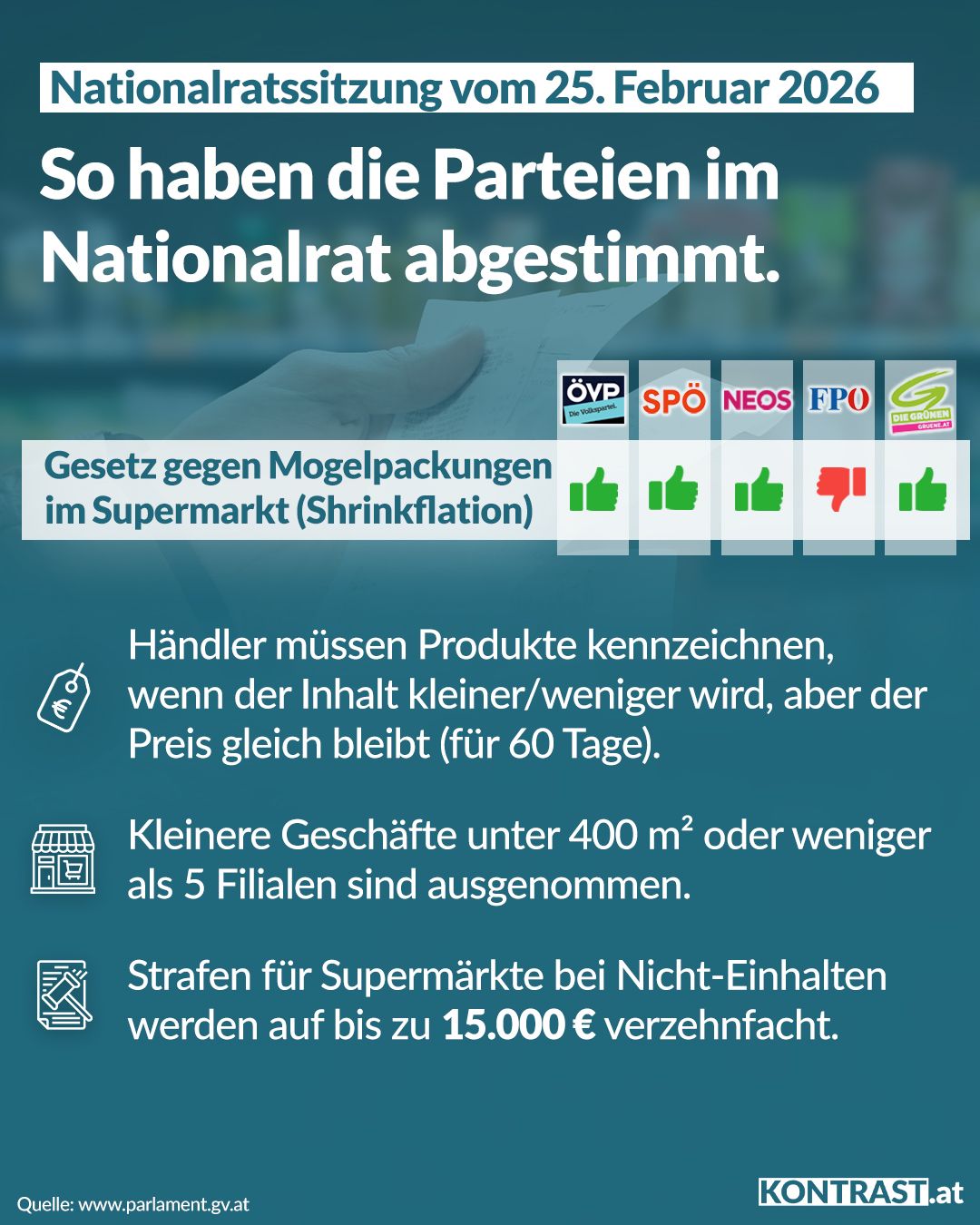



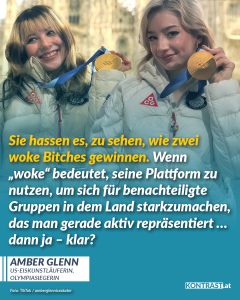

Nur weil Herr Mateschitz hier schon wieder als das personifizierte ‚Böse‘ dargestellt wird: Herr Mateschitz sen. hat mehr für Österreich getan und bewirkt, als jeder Politiker der letzten 50 Jahre. Auch und gerade im Sozialbereich. Er und sein Sohn hätten sowohl das Vermögen als auch die Arbeitsplätze schon lange ins Ausland transferieren können, wo ihnen nicht so feindlich begegnet wird. Dafür, dass sie das nicht getan haben, sollte man ihnen eigentlich danken und sie nicht wie ‚Verbrecher‘ behandeln. Der ‚Staat‘ hätte dieses Vermögen übrigens schon längst sinnlos in den Sand gesetzt (wie man anhand der momentanen Budgetsituation va in Wien eindrucksvoll sieht).