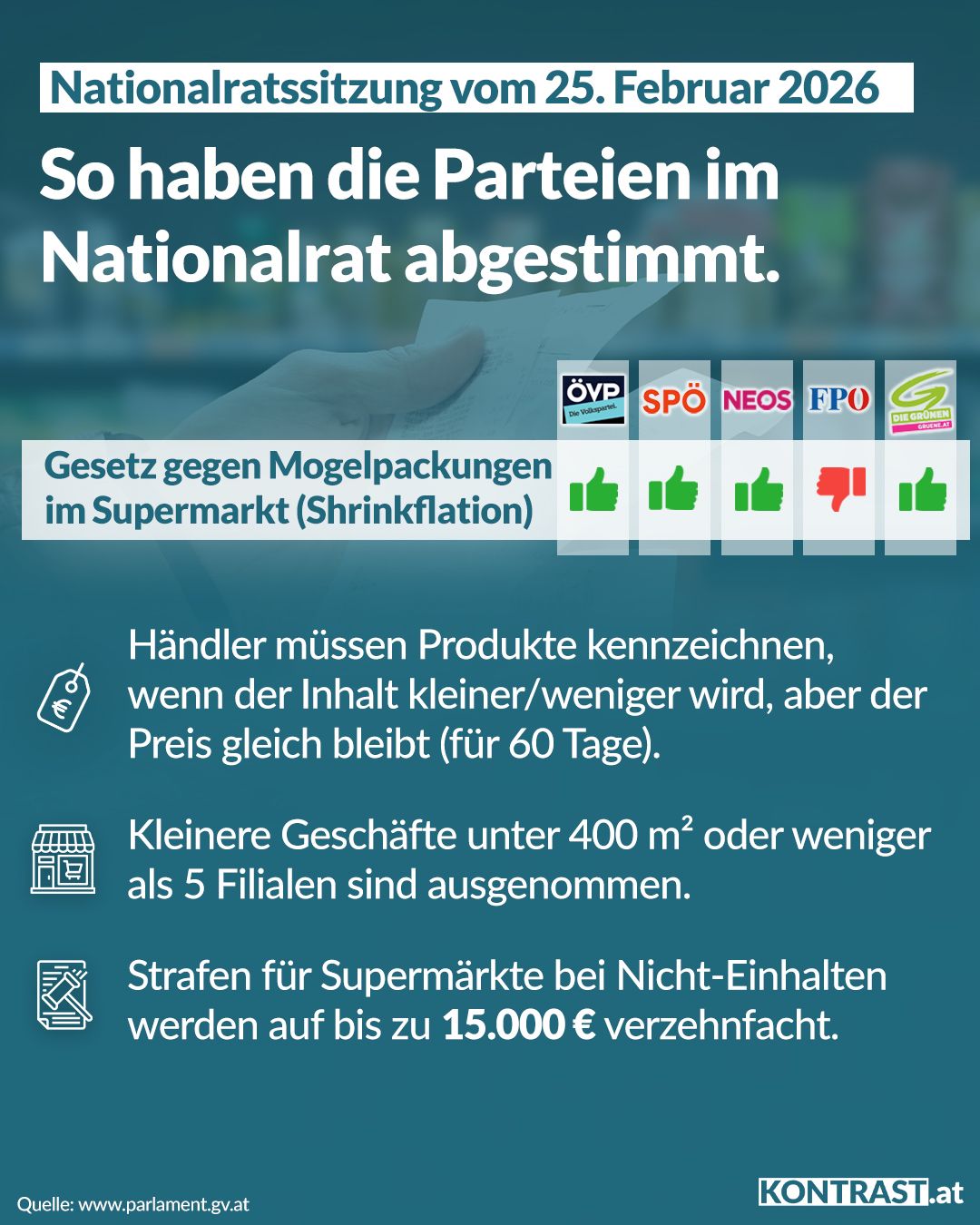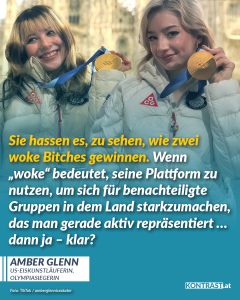Jetzt haben wir also doch wieder die „Expertenregierung“ als eine ernsthafte Option. Grund genug, sich mit dem Modell einmal gründlicher auseinanderzusetzen. Ein Beitrag von Verfassungsexperte Manfred Matzka.
Zunächst sollten wir mal mit ein paar Kalauern aufräumen. Der erste, „die Regierung Bierlein hat ja bloß verwaltet und nicht gestaltet“, ist schlichtweg falsch: Die Zahl der Ministerratsbeschlüsse und der Regierungsvorlagen dieser Monate war genauso groß wie bei der vorherigen Regierung. Ich habe da aus bekanntem Grund genau mitgezählt. Und man hat ohne Zores einen EU-Kommissar installiert und den Budgetvollzug konsolidiert. Und im Übrigen ist „nur“ ordentlich verwalten auch etwas, was manche Parteienregierungen erst einmal zusammenbringen müssen – nicht alle haben das bisher immer geschafft.
Der zweite Kalauer lautet „die können kein Budget zusammenbringen“. Warum aber sollte es nicht möglich sein, das meiste von dem, was in den bisherigen Verhandlungen zur Konsolidierung bereits konsentiert wurde, in eine Regierungsvorlage zu schreiben und diese mit Mehrheit im Nationalrat zu beschließen. Der massive Druck aus Brüssel, dass man rasch ein Bundesfinanzgesetz beschließen muss, wird das erzwingen. Und da wird jede Partei bei einzelnen Punkten halt die Zähne zusammenbeißen – auch weil sie danach ja immer noch die Option hat, mit anderen Parteien, mit denen sie eine Mehrheit zustande bringt, Punkte, die ihr besonders weh tun, durch eine Novelle abzuändern.
Wechselnde Mehrheiten könnten größere Projekte ermöglichen
Und solche wechselnden Mehrheiten bieten sich auch für größere Projekte der Sachpolitik an. Da werden ÖVP und Freiheitliche einige harte Migrationsregeln machen, SPÖ und FPÖ eine Bankenabgabe, aber auch zwischen anderen Parteien können Kompromisse in den Bereichen Sozialpolitik, Umweltpolitik oder Bürokratie und Wirtschaft gefunden werden. Da kann insgesamt durchaus was weitergehen und die Wähler werden das mehr goutieren als den unproduktiven Streit.
Der Unterschied eines solchen Systems zu bisher liegt nur darin, dass diese Regierung nicht sofort, wenn sie mit einer Vorlage scheitert, beleidigt alles hinschmeißt, und dass sie auch das vollzieht, was sie ursprünglich nicht haben wollte. Denn für sie gilt nach der Verfassung: Die gesamte Vollziehung hat aufgrund der Gesetze zu erfolgen. Das weiß eine solche Regierung, sie kann vollziehen, und sie wird es professionell und ohne Geschrei tun. Daher stimmt der Begriff „Expertenregierung“ nicht.
Der wesentliche Unterschied besteht nämlich nicht darin, dass hier Experten werken und in einer Parteienregierung Dilettanten. Auch in jenen gab es immer auch Experten. Ums Wissen aber geht es nicht. Es geht darum, woran sich die Regierung, ein Minister, orientiert:
Daran, in der Sache eine Lösung zu finden, die mehrheitlich anerkannt wird – oder daran, mit Werbung und PR die eigene Klientel begeistert bei der Stange zu halten und von den anderen ein paar Stimmen abzuzwacken.
Geht es darum, wegen der eigenen Leistung gut dastehen zu wollen, oder darum, den anderen als bösen Versager schlecht ausschauen zu lassen. Die Nichtparteien-Regierung braucht nichts abzuzwacken und muss niemanden schlecht machen.
Menschen, die ein solches Regierungshandwerk können, gibt es. Anderswo mehr als in den Führungsetagen der politischen Parteien. Denn hier hat man nicht erst in den letzten Monaten gesehen, dass es sich rächt, wenn man in der Partei keinen hochbegabten Politnachwuchs heranzieht oder ranlässt. Man erlebt, was es bedeutet, wenn sich die führenden Funktionäre in Parteien nobel zurückhalten und nur die zweite Reihe an die Front schicken – die dann natürlich die Sache vergeigen. Es gibt im sozialen Umfeld aller Parteien Menschen, die sachpolitisch denken, Politik in der Sache machen wollen und können – besser als die Politik der Kommunikation, des spins und des Moralisierens. Lassen wir sie doch ran.
Entscheidend ist die Mehrheit im Parlament – sie gibt die Gesetze vor
Viele können sich das nicht vorstellen, weil es seit Jahrzehnten nicht so war, dass die Regierung sachpolitisch fokussiert arbeitete und die großen gesellschaftspolitischen Weichenstellungen dem Parlament und damit der Mehrheit im Lande überließ. Aber diese Arbeitsteilung gibt es durchaus in anderen Demokratien wie etwa in Dänemark und sie hat es auch in unserem Land gegeben. So waren zum Beispiel in der Ersten Republik die längste Zeit Bundeskanzler und Vizekanzler keine Parteiobmänner. Und das Modell unserer Verfassung ist eigentlich darauf ausgelegt:
Entscheidend soll die Mehrheit im Parlament sein. Sie gibt die Gesetze vor – auch dann, wenn diese einander gesellschaftspolitisch widersprechen, wenn sie nicht einer großen politischen Linie folgen. Gesetze sind Gesetze. Und die Regierung ist an sie strikt gebunden, sie hat sie zu vollziehen. Und wenn sie es nicht kann, dann macht sie einer anderen Platz und rächt sich nicht am Parlament und am Volk dadurch, dass man den Nationalrat auflöst und neu wählt.
„Probieren wir es doch wieder“ – auch wenn es nicht leicht ist
Natürlich ist das auch kein leichtes Geschäft. Es verlangt von der Regierung Demut gegenüber dem Souverän. Sie kann der Parlamentsmehrheit nichts anschaffen. Sie muss Abgeordnete für Initiativanträge kundig und engagiert servicieren. Sie muss ihre Projekte lange, eingehend und ehrlich mit den Klubs vorbesprechen. Sie muss viel am Arbeitstisch beraten und darf nicht über Medien ihr Gegenüber düpieren. Sie braucht die Sozialpartner, die Zivilgesellschaft, die Intellektuellen als Partner. Ist das schlecht?
Probieren wir es doch wieder. Es wird nicht ewig halten – aber länger als die letzten Chaosmonate. Und in dieser Zeit kann man den Sprengmeistern, die jede Koalition schon vorweg damit zerstören, dass sie das Gegenüber mit schrillen Dogmenpapieren oder Vorsitzenden-Bashing demütigen, das Dynamit wegnehmen. In dieser Zeit lässt man die Pfauinnen und Pfaue wieder von den Bäumen herunterkommen, wo sie entrüstet aufgeplustert sitzen. Die Tisch-Aufsteher und Ultimatensetzer werden lernen, Argumente der Anderen anzuhören und sachlich zu erwidern. In der Zeit werden sich sogar neue Talente aus dem Kreis der Minister(innen) kristallisieren, die etwas können und einer Partei politisch nahestehen – denn ein unpolitischer Mensch gehört ja auch nicht in eine solche Regierung.
Unsere Verfassung ist nicht nur schön. Sie bietet sogar die Möglichkeit, selbst in der derzeitigen verfahrenen Situation optimistisch in die Zukunft der Republik zu denken.

Manfred Matzka, Jurist, langjähriger Präsidialchef des Bundeskanzleramtes, Minister- und Kanzlerberater, ist ein fundierter Kenner des politischen Tagesgeschäfts in Österreich. Er arbeitete 40 Jahre im Bundesdienst, lange auch als Kabinettschef, wurde von der Politik als Insider akzeptiert und respektiert und hält mit seiner stets ebenso gut begründeten wie pointierten Meinung nicht hinter dem Berg.
Er ist Autor der Bestseller „Die Staatskanzlei“ sowie „Hofräte, Einflüsterer, Spindoktoren“ und brachte 2023 sein neues Buch „Schauplätze der Macht. Geheimnisse, Menschen, Machenschaften“ heraus. In seiner Kontrast-Kolumne „Inside Staatsapparat“ bewertet er aktuelle politische Ereignisse und Regierungsvorhaben aus verfassungsrechtlicher Perspektive.