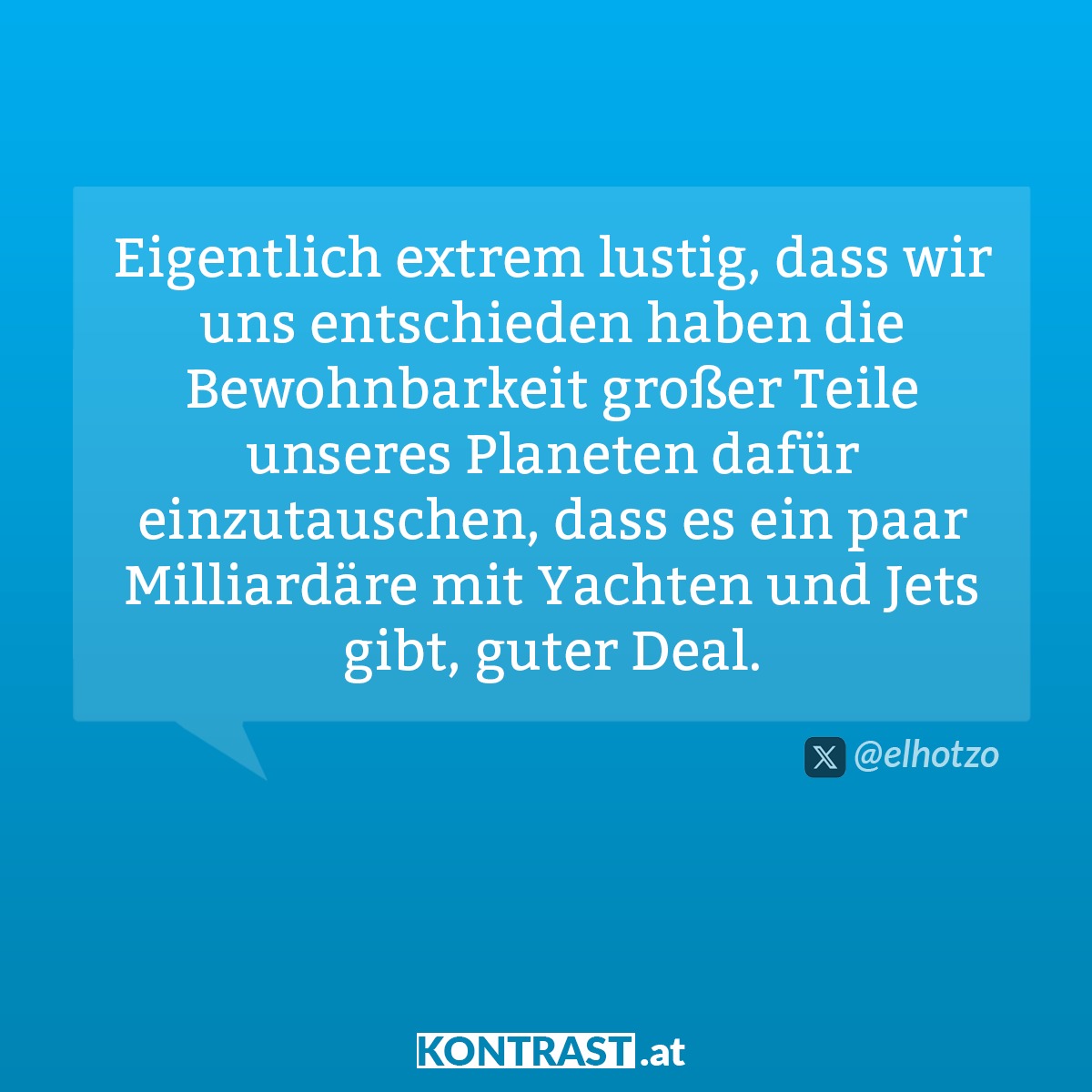Es gibt einen Klassenkampf – aber einen, über den wir zu wenig reden: Den Klassenkampf, den die Elite führt, indem sie ihre Kapitalinteressen durchsetzen. Zum Leidwesen der vielen. Anders als bei Streiks, Petitionen und Co. finden diese Kämpfe allerdings nicht laut in der Öffentlichkeit statt, sondern man agiert im Verborgenen. Wie der „Klassenkampf von oben“ funktioniert und wie er dazu beiträgt, Armut zu verfestigen, Arbeitszeiten auszuweiten und die Mehrheit der Bevölkerung im Hamsterrat laufen zu lassen, erzählen Natascha Strobl und Michael Mazohl in ihrem gleichnamigen Buch. Wir haben sie zum Gespräch getroffen.
Kontrast: Euer Buch trägt den Titel „Klassenkampf von oben“. Wenn man „Klassenkampf“ hört, denkt man zuerst an Demos, vielleicht auch Streiks oder zähe KV-Verhandlungen. Also Kämpfe „von unten“. Wer führt nun den Klassenkampf von oben?
Michael Mazohl: Den Klassenkampf von oben führen in erster Linie die wirtschaftlich Mächtigen. Industrielle, Banker – und Vermögende, die Kraft ihres Reichtums in der Lage sind, ihre Interessen durchzusetzen und gesetzliche Änderungen zu ihren Gunsten herbeizuführen.
Kontrast: Klassenkampf klingt recht rabiat. Als ob da mit harten Bandagen gekämpft wird. Wie kämpf diese Elite, von der ihr sprecht?
Natascha Strobl: Das ist im Grunde das Paradoxe. Der Klassenkampf von oben ist kein lautes Eintreten einer Masse an Menschen für ein Ziel. Der Klassenkampf von oben funktioniert leise, verdeckt. Er ist wird diskret geführt – aber die Folgen spüren wir am Ende alle. Die Elite führt ihn über Think Tanks und argumentative Vorarbeit. In dieser Gruppe hängen Leistung und Vermögen nicht zusammen. Das Vermögen ist da und soll abgesichert werden – und dafür arbeitet man.

Kontrast: Wer sind die Akteur:innen, die diesen Kampf führen – in Österreich?
Strobl: Nun ja, „das Kapital“ besteht aus vielen Organisationen, auch Interessensvertretungen – WKÖ, IV – oder auch informellen Netzwerken. Bei Letzteren verwischen auch die Grenzen zwischen privat und beruflich. Es gibt Treffen – oder auch schöne Networking-Veranstaltungen oder Partys – zu denen man als normaler Mensch nie hingehen könnte. Und bei solchen Treffen werden wirtschaftliche Deals eingehängt, werden politische Vorhaben besprochen, Kontakte ausgetauscht. Das sind offiziell dann irgendwelche „Adventzauber“-Partys in Ballsälen, wo es aber nicht ums Punschtrinken und Lebkuchen-Essen geht, sondern ums Netzwerken, um Politik, um Börsen-Wissen oder Ähnliches. Und dann gibt es natürlich auch noch außerparlamentarische Institute, also die nicht sozialpartnerschaftlich eingebunden sind. Think Tanks wie die Agenda Austria zum Beispiel. Die verbreiten Argumente für das Kapitalinteresse in der breiten Gesellschaft.
Mazohl: Ganz plakativ könnte man auch sagen: Man kann oder sollte sich anschauen, wer hinter diversen Denkfabriken steht. Die haben ja auch eigene Förderkreise. Und aus denen kann man ablesen, wer diejenigen sind, die im Land die Interessen des Kapitals vertreten. Man kann sich anschauen, wer welcher Partei großzügig Spenden überwiesen hat – und welche Gesetze dann gekommen sind. 12-Stunden-Tag, Senkung der Gewinnsteuer, all das.
„Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt – und wir gewinnen.“ (Warren Buffet, US-amerikanischer Unternehmer und Milliardär)
Kontrast: Ihr problematisiert in eurem Buch den „Mittelstandsbegriff“. Warum? Der ist ja auch alltagssprachlich verbreitet?
Mazohl: Wenn wir uns ansehen, wie Wohlstand – konkret über Vermögen – in der Gesellschaft verteilt ist, dann müssen wir feststellen, dass es in Österreich praktisch keinen Mittelstand gibt. Wir haben stattdessen die Situation, dass das reichste Prozent der Bevölkerung die Hälfte des Vermögens besitzt.

Strobl: Spannend ist jedoch, dass sich dennoch so viele Menschen dem vermeintlichen Mittelstand zugehörig fühlen. Wir kennen das aus Erhebungen der Nationalbank. Dort wird erhoben, wie viel Vermögen die Haushalte haben und wie sie sich ökonomisch selbst einordnen. Und dort kommt heraus, dass sich sowohl jene, die wenig haben, der Mittelschicht zuordnen – aber auch jene, die zu den sehr Vermögenden gehören. Man merkt, der Mittelstands-Begriff ist Projektionsfläche und wird daher auch instrumentalisiert.
Wer nur über den Mittelstand redet, sorgt dafür, dass man nicht auf die schaut, die ganz oben stehen – und danach fragt, was die so tun.
Kontrast: Was macht man mit dieser Erkenntnis? Mit welchen Begriffen sollte man stattdessen arbeiten, wenn jetzt z.B. „Mittelstand“ realitätsverzerrend ist?
Strobl: Vielleicht wäre es sinnvoller, wieder das Augenmerk darauf zu richten, wie Menschen ihren Lebensunterhalt bestreiten. Also: Ob sie arbeiten müssen – ob mit Kopf und/oder Händen – oder eben nicht. Ob sie selbst arbeiten müssen oder ob sie nur andere Menschen für sich arbeiten lassen. Denn das macht den Unterschied. Und dann merkt man: Es gibt die Vielen, die – auch wenn sie angestellt sind und gut verdienen – zur arbeitenden Klasse gehören. Und es gibt die, die diese Klasse für sich arbeiten lassen bzw. die von ihrem Besitz leben können.
Kontrast: Ihr sprecht in eurem Buch viele verschiedene Verteilungsfragen an. Vermögensverteilung, Lohnverteilung – aber eben auch Arbeitszeitverteilung. Von Gegner:innen einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung hört man, dass das nicht ginge, weil es in Branchen wie Gesundheitsdiensten, in Sozial- und Bildungsberufen keine Produktivitätssprünge gibt, die das ausgleichen.
Mazohl: Es ist interessant, dass es gerade der Sozialbereich ist, wo im Kollektivvertrag als erstes eine Arbeitszeitverkürzung durchgesetzt wurde. Die ist aber auch noch stärker notwendig. Denn die Anforderungen in diesem und den anderen Bereichen sind gestiegen. Der Arbeitsdruck auf die Beschäftigten ist enorm. Und die Fehleranfälligkeit steigt, je länger man arbeitet. In der Pflege ist das gefährlich. Die Beschäftigten brauchen dringend kürzere Arbeitszeiten.
Strobl: Es kommt wohl nicht von ungefähr, dass ausgerechnet die Branchen angeführt werden, in denen vor allem Frauen arbeiten. Und zwar mit Teilzeitstellen – und nicht Vollzeit, wohlgemerkt. Die schultern diese Branchen und diese gelingen mit kürzeren Arbeitszeiten schon jetzt. Allerdings ohne Lohnausgleich. Und denen vermittelt man, dass man von ihnen nun mal persönlichen Einsatz fordert. Diese Beschäftigten sollen sich aufopfern – denn es sind ja „soziale“ Berufe, die man aus Überzeugung machen soll. Egal, wie schwierig die Bedingungen sind. Von einem Industriearbeiter verlangt niemand, dass er sich persönlich aufopfern soll. Zurecht, natürlich. Und da muss man sich fragen: Wie soll das in Zukunft funktionieren? Es kracht ja schon jetzt an allen Ecken und Enden.
Mazohl: Der „Pflexit“ ist ja bittere Realität. Es steigen mehr Personen aus dem Beruf aus als ein. Ziel müsste sein, diesen und andere Berufe attraktiver zu machen – das heißt: schaffbarer zu machen. Denn er geht mit körperlichen und psychischen Belastungen einher.
Kontrast: Statt den Weg frei zu machen für kürzere Arbeitstage, hat man 2018 das Gegenteil gemacht und längere Arbeitstage erlaubt. Der 12-Stunden-Tag wurde damals verkauft als Mittel hin zu mehr Flexibilität und darum mehr Freiheit. Hat sich dieses Versprechen erfüllt?
Strobl: Das Versprechen war natürlich immer eine Chimäre. Wie soll es mehr Freiheit oder Freizeit geben, wenn ich länger arbeiten muss? Kindergärten, Banken, Schulen und dergleichen aber trotzdem fixe Zeiten haben natürlich. Im Gegenteil: Der 12-Stunden-Tag bedeutet real mehr Stress. Man muss noch mehr und länger verfügbar sein.
Man verlangt es der arbeitenden Klasse schlicht ab, ständig verfügbar zu sein. Dabei wäre es heutzutage attraktiver, wenn man sagt: „Wenn du rausgehst aus der Arbeit, kannst du das Handy abdrehen und bevor du wiederkommst am nächsten Tag, brauchst du auch nicht erreichbar zu sein.“
Mazohl: Für die Beschäftigten hat sich das, was versprochen wurde, nicht erfüllt. Die wenigsten können sich frei aussuchen, wie lange sie arbeiten. Die Sprechstundenhilfe entscheidet nicht die Öffnungszeiten der Praxis, der Arbeiter am Bau entscheidet nicht, wie viel am Tag geschafft werden muss, die Kassiererin entscheidet keine Geschäftszeiten. Flexibilität dient den Arbeitgebern. Jetzt werden, das wissen wir aus Befragungen, Pausen- und Ruhezeiten nicht eingehalten – Strafen gibt es aber keine. Auch nicht bei anderen Übertretungen.

Kontrast: Eine ganz andere Baustelle, wo eurer Ansicht nach der Klassenkampf ausgetragen wird, ist der Arbeitsmarkt als Ganzes. Seit 40 Jahren halten Regierungen an derselben Strategie fest: Einschnitte in der Sozialversicherung, mehr Druck auf Jobsuchende – und trotzdem bessert sich die Gesamtsituation nicht. Warum hält man an der Strategie also fest?
Mazohl: Es wäre natürlich im Sinn einer gesunden Volkswirtschaft, wenn die Arbeitslosenquote niedrig ist. Aber für Kapitalinteressen ist Arbeitslosigkeit ein gewünschtes Mittel. Denn das bedeutet mehr Lohndruck, aber auch weniger Spielraum für Gewerkschaften in Verhandlungen. Und wir sehen ja, die Strategie besteht weiter. Ein degressives Arbeitslosengeld bedeutet mehr Angst und weniger Sicherheit für Jobsuchende.
Kontrast: Auf der anderen Seite stehen dann die Unternehmen, die – wie sie sagen – um Fachkräfte ringen. Geklagt wird vor allem in der Gastronomie und im Tourismus. Warum ist dort ein Mangel an Arbeitskräften so groß – in anderen Branchen, etwa der Industrie, aber nicht?
Strobl: Nunja, es liegt vor allem am Geld. Gastro und Tourismus sind harte Arbeitsfelder – und die Jobs dort werden unattraktiv gestaltet. Die Arbeitsorte sind dezentral, die Arbeitszeiten sind lang, es wird viel Aufopferung für den Betrieb abverlangt, man sieht die Familie wenig. Wenn ich will, dass Menschen für mich arbeiten und meine Gewinne erwirtschaften, muss ich sie gut behandeln und gut bezahlen. Warum sollte jemand eine intrinsische Motivation haben, in irgendeinem Skigebiet monatelang zu leben und zu arbeiten, ohne Familie? Oft noch ohne Sicherheit?
Wenn dein Betrieb nur funktioniert, weil du Leute schlecht bezahlst und du dir höhere Löhne nicht leisten kannst, dann funktioniert dein Geschäftsmodell nicht. Auch das ist Kapitalismus. Marktregeln gelten auch für Unternehmen.
Mazohl: Zur Industrie: Dort macht man ja einiges, um sich die eigenen Fachkräfte auszubilden. In der Branche gibt es zudem die meisten Betriebsräte, dort werden gute Arbeitsbedingungen ausverhandelt. Es gibt gute Lehrwerkstätten, man fördert Fortbildungen. Da besteht das Interesse, dass die eigenen Leute etwas können, übernommen und gehalten werden. Man schafft sich also seine künftigen Fachkräfte.
In Hotellerie und Gastro gibt es keinen Mangel an Fachkräften. Es gibt einen Mangel an guten Arbeitsbedingungen.
Strobl: Dass Beschäftigte Menschen mit einem Leben sind, darauf nehmen zu viele Betriebe keine Rücksicht. Du sollst tiptop ausgebildet sein – am besten woanders, denn selbst Lehrlinge ausbilden will man ja auch oft nicht. Man soll unter dreißig sein, keine Kinder haben und keine Kinder wollen, für immer in Österreich leben, immer gesund sein, für den Rest des Lebens im Betrieb bleiben – und nur ja keine Angehörigen haben, um die man kümmern muss. Denn dann könnte man ja ausfallen. Was ist das für ein Menschenbild? Fakt ist aber: Menschen haben als Priorität in ihrem Leben nicht ihre Arbeit, sondern die ist ein Mittel zum Zweck – der Zweck heißt: Leben, mit allem, was dazugehört. Wenn Unternehmer das einsehen und sich darauf einstellen würden, dann würden sie auch Arbeitskräfte bekommen.
Kontrast: Ein Thema, das euch auch beschäftigt, ist Kinderarmut. In Österreich ist jedes 5. Kind arm oder armutsgefährdet. Parteien, die von sich behaupten “Familienparteien” zu sein, unternehmen allerdings nichts dagegen, dass Kinder hierzulande in kalten Wohnungen schlafen, kein Fahrrad haben oder sich nicht mal das Eis im Sommer kaufen können. Wieso kommen die mit ihrer Erzählung durch?
Mazohl: Es gibt schlicht keinen politischen Willen, Kinderarmut abzuschaffen. Denn anstatt zweieinhalb Milliarden Euro in die Hand zu nehmen, die es bräuchte, um Kinderarmut zu beenden, nimmt das Geld lieber und schenkt es Unternehmen – weil man die Steuer auf Konzerngewinne senkt. Nur einmal geht es um das Leben von 320.000 Kindern, das andere Mal um Kapitalinteressen. Letztere setzen sich in Österreich offenkundig leichter durch.
Strobl: Über Kinderarmut zu schreiben ist eines der schwierigsten Kapitel des Buches gewesen. Weil es so ärgerlich ist, dass es das noch immer gibt. Zum Familienbegriff, den die selbst ernannten „Familienparteien“ vor sich hertragen, muss man sagen: Diese Parteien und diese Leute sind ja nicht für alle Familien. Sie sind nur für bestimmte Familien. Offensichtlich helfen sie nicht armen Familien – der Familienbonus richtet sich ja an gut verdienende Eltern. Sie sind für heterosexuelle, nicht-muslimische Familien, am besten ohne Migrationshintergrund. Man muss halt immer genau hinhören, wenn jemand behauptet „für Familien“ einzutreten. Es ist ein Marketing-Gag. Denn da werden viele, viele Familien bewusst ausgeschlossen.
Kontrast: Wie begegnet man all dem nun am besten? Immerhin leben wir in einer Gesellschaft, in der sich nicht jeder und jede nur einem der beiden Klassen zugehörig fühlt und sonst keine Identitäten hat. Realität sind ist stattdessen eine Vielzahl von Identitäten und Kämpfen, die in der Gesellschaft geführt werden.
Strobl: Man muss die Realität nehmen wie sie ist. Ich kann mir nicht aussuchen, was Menschen politisiert. Es gibt zum einen eine Kulturkampf-Ebene, in er es darum geht, Identitäten abzusichern. Und es gibt die Klassenkampf-Ebene, in der es um materielle Interessen geht. Diese beiden Ebenen sind aber miteinander verwoben. Wenn Politiker:innen sagen, sie wollen die Mindestsicherung kürzen, geht es um mehrere Dinge gleichzeitig: Es richtet sich gegen jene, die von den Eliten als „faul“ gebrandmarkt werden – und gegen jene, die man als „fremd“ tituliert. Was uns jedenfalls in der Abwehr nicht weiter bringt, ist, sich ständig darüber zu streiten, welcher Kampf wichtiger ist als ein anderer.
Es ist in Ordnung, dass Menschen mehrere Kämpfe führen und für mehrere Ziele eintreten. Auch für Ziele, die für einen selbst vielleicht nicht oberste Priorität haben – aber die auch wichtig sind, weil sie dazu beitragen sollen, die Welt für alle lebbar und besser zu machen. Wir wollen ja alle eine Zukunft. Das ist ein revolutionäres Statement im Jahr 2022.
Mazohl: Ein guter Zugang ist vielleicht, dass wir uns im Versuch, die Welt besser zu machen, nicht gegenseitig unnötig blockieren. Es versuchen schon genug Leute von oben, uns alle, die Vielen zu spalten. Alt gegen Jung, arbeitend gegen jobsuchend, Einheimische gegen „die Ausländer“. Diese Spaltung ist eine Waffe des Klassenkampfes von oben. Da sollten wir nicht mitmachen. Sondern sollten uns solidarisieren, wo wir können. Beim Streik der ÖBB haben wir von der Agenda Austria das Argument gehört, dass die ÖBB ja ein staatsnahe, privilegierter Betrieb ist. Und warum trauen sich die überhaupt mehr zu fordern als die Handelsangestellten? Und da wird ja auch nichts anderes gemacht als einen Konflikt zu schüren, der eigentlich nicht besteht. Denn wenn eine Branche gute KV-Abschlüsse hat, ist es auch Druckmittel für andere Branchen.
Strobl: Das Gute ist: Die, die den Klassenkampf von oben führen und immer geführt haben, hatten zwar Land, Titel und Vermögen – aber sei waren immer in der Minderheit. Und es waren die Massen, die die Umbrüche herbeigeführt haben. Und das ist auch heute noch so. Unsere Stärke ist, dass wir in der Mehrheit sind.