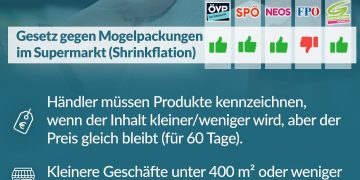Seit Beginn der österreichischen Impfkampagne mit dem ersten medienwirksamen Stich am 27. Dezember 2020 häuft sich die Kritik an der österreichischen Impfstrategie, sofern man überhaupt von einer solchen sprechen kann. Ist die Kritik berechtigt? Und wenn ja: Was ist falsch gelaufen? Sicher ist, dass die Regierung ihr Ziel bei weitem verfehlen wird, bis Ende März alle über 65-Jährigen zu impfen.
Gemeinsame EU-Beschaffung
Bis Ende März soll allen über 65-jährigen Menschen in Österreich eine Impfung gegen Covid-19 angeboten werden, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz im Jänner 2021 verkündet. Davon ist Österreich weit entfernt. Um die Schwachstellen der österreichischen Impfstrategie aufzudecken, muss man zunächst etwas ausholen und sich die gemeinsame Beschaffung der Impfstoffe durch die EU ansehen. Gehen wir also zurück an den Anfang: Im Sommer 2020 entschied die EU-27 in einem selten zuvor demonstrierten Akt der Einigkeit, die Impfstoffbeschaffung nicht den einzelnen Nationalstaaten zu überlassen, sondern gemeinsam Impfstoffe anzukaufen. Ein Wettlauf zwischen den Mitgliedsstaaten sollte verhindert werden.
So weit, so vernünftig. Den Pharmakonzernen die Verhandlungs- und Marktmacht der EU und ihren rund 450 Millionen Einwohnern gegenüberzustellen, war mit Sicherheit kein Fehler. Clemens Martin Auer, Covid-Sonderbeauftragter des Gesundheitsministeriums und Co-Vorsitzender des Lenkungsausschusses, in dem die EU-Mitgliedsstaaten die Corona-Impfstoffbeschaffung der EU-Kommission steuern und überwachen, berichtet, dass einzelne Hersteller zu Beginn 120 Euro pro Impfstoffdosis verlangt hätten und die Firmen Vertragsklauseln einbauen wollten, die alle Haftungsklauseln ausgehebelt hätten. Kostentechnisch haben sich die gemeinsamen Verhandlungen offenbar gerechnet. Ist doch mittlerweile durchgesickert, dass die EU für das Präparat von Biontech/Pfizer pro Dosis zwischen 12 und 15,50 Euro, für das von Moderna umgerechnet rund 15 Euro und für das von AstraZeneca 1,78 Euro bezahlt.
Auch dass die EU auf sechs verschiedene Impfstoffe gesetzt hat, kann man ihr nicht ankreiden. So war zum Zeitpunkt der Verhandlungen weder bekannt, welcher Impfstoff am besten wirken, noch welcher als erstes bzw. überhaupt die Zulassung erhalten werde. Die Risikoverteilung auf sechs Hersteller war aus damaliger Sicht also keine schlechte Strategie.
Dennoch sind österreich- und EU-weit heute viel weniger Menschen geimpft als etwa in Israel, Großbritannien oder den USA. Was sind die Gründe dafür?
Stimmt es, dass die EU zu spät bestellt hat?
Lieferprobleme, zunächst beim Biontech/Pfizer- und dann auch noch beim AstraZeneca-Impfstoff, haben die Impfpläne vieler EU-Staaten zuletzt durcheinandergeworfen. Auf die Vorwürfe, AstraZeneca würde andere Länder außerhalb der EU bevorzugt beliefern, reagierte der Konzernchef Pascal Soriot achselzuckend mit der Aussage, die EU habe einfach zu spät bestellt. Sowohl EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als auch Clemens Martin Auer wiesen diese Deutung zurück. Ganz von der Hand zu weisen ist die Behauptung Soriots allerdings nicht. Der Vertrag mit Großbritannien wurde drei Monate vor dem Vertrag mit der EU abgeschlossen.
In den USA wurden ebenfalls keine Kosten und Mühen gescheut, um im Wettlauf um den Corona-Impfstoff die Nase vorn zu behalten. Während Trump bereits im Juli einen Vertrag mit dem Impfstoff-Hersteller Pfizer abgeschlossen hatte, gelang es der EU erst vier Monate später, und zwar im November.
Auch Israel hat bereits im Sommer bei Moderna und im Herbst dann bei Biontech/Pfizer bestellt. Im Gegensatz dazu soll die EU in den Verhandlungen sogar auf bis zu 340 Millionen angebotene Dosen von Biontech/Pfizer und Moderna verzichtet haben. Nachbestellungen wurden zwar mittlerweile getätigt, geliefert werden die zusätzlichen Dosen aber wohl erst in der zweiten Jahreshälfte 2021, weil die Firmen nun zunächst andere Lieferverpflichtungen erfüllen müssen.
Kamen erste Zulassungen in der EU zu spät?
Aber nicht nur bei der Bestellung der Impfstoffe war die EU im Verzug, auch bei der Zulassung hinkte man hinterher. Als erstes Land weltweit hatte Großbritannien Anfang Dezember den Impfstoff von Biontech/Pfizer mit einer Notfallzulassung zugelassen. Eine Woche später folgte die USA und startete am 14. Dezember die größte Impfkampagne ihrer Geschichte. In Israel wird seit dem 19. Dezember im Rekordtempo gegen Corona geimpft. Der AstraZeneca-Impfstoff wird in Großbritannien seit Anfang des Jahres, ebenfalls nach einer Notfallzulassung, verimpft. Währenddessen gab die Europäische Arzneimittelbehörde erst am 21. Dezember grünes Licht für die Zulassung des Biontech/Pfizer-Impfstoffs, Ende Jänner dann schließlich für den AstraZeneca-Impfstoff.
Man könnte einwenden, dass eine schnellere Zulassung der Sorgfaltspflicht widersprochen hätte, zumal gerade bei dem in Großbritannien breit verimpften AstraZeneca-Präparat die Wirksamkeit für die Gruppen über 65 Jahre nicht einwandfrei geklärt ist. Wenn die Alternative dazu allerdings ist, dass die besonders gefährdeten Gruppen monatelang gar nicht geimpft werden und so nicht einmal die Chance besteht, einen Impfschutz aufzubauen, stellt sich die Frage, was schwerer wiegt.
War die EU zu geizig?
Zehn Milliarden Dollar haben die USA in unterschiedliche Pharma-Konzerne investiert, um das finanzielle Risiko der Impfstoffentwicklung für Forschung und Unternehmen gering zu halten. Großbritannien hat 230 Millionen Pfund in die Ausweitung der landeseigenen Impfstoffproduktion gesteckt. In Israel zahlt der Staat doppelt so viel pro Dosis des Biontech/Pfizer-Impfstoffes wie die EU, nämlich 23 Euro statt 12 Euro. Darauf angesprochen, ob die EU nicht mehr Geld in die Hand nehmen hätte können, um die Pharmakonzerne dazu zu bewegen, die Produktion hochzufahren, sagt Clemens Martin Auer in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung:
„So einen Schwachsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört. […] Auch wenn wir den Herstellern viermal so viel bezahlt hätten oder jetzt bezahlen würden, hätten wir im Moment keine höheren Produktionskapazitäten.“
Eine kühne These angesichts der Tatsache, dass gerade die weltweiten Impfvorreiter in Sachen Impfstoff alles andere als gespart haben.
Zweifelsohne sollte es keine Frage des Geldes sein, ob und wie schnell die Immunisierung der Bevölkerung voranschreitet. Pharmakonzerne sollten – gerade in Zeiten einer Pandemie – nicht nach Gewinnmaximierung streben, sondern im Sinne des Gemeinwohls agieren. Dass die Realität anders aussieht, ist bekannt. Das Geldargument ist daher, wenn es um die Erklärung der unterschiedlichen Impfgeschwindigkeiten in unterschiedlichen Ländern geht, nicht außer Acht zu lassen.
Teure Verzögerung
Ohnehin droht die Taktik, beim Thema Impfstoffbeschaffung über das gebotene Maß hinaus zu sparen, ins Gegenteil umschlagen. Dass die europaweite Verzögerung bei den Impfungen nicht nur menschliches Leid erzeugt, sondern auch wirtschaftlich hohe Kosten verursacht, hat nämlich jetzt eine erste Studie des deutschen Kreditversicherers Euler Hermes berechnet. Laut dieser Studie liegen die EU-Staaten beim Impfen mit Stand Anfang Februar rund fünf Wochen zurück. Gelingt es nicht, diese Verzögerung aufzuholen, könnte der EU durch weitere Lockdowns und Corona-Einschränkungen ein Schaden von bis zu 90 Milliarden Euro im heurigen Jahr drohen. Allein für Österreich schätzt der Kreditversicherer wöchentliche Lockdown-Kosten von rund 500 Millionen Euro. Im Vergleich dazu: Für die 30,5 Millionen Impfstoffdosen, die Österreich mit Stand 10. Februar bisher bestellt hat, fallen Kosten von 388,3 Millionen Euro an.
Unerwähnt soll an dieser Stelle jedoch auch nicht bleiben, dass Israel den frühzeitigen Zuschlag für die Biontech/Pfizer-Impfdosen nicht nur wegen der größeren Zahlungsbereitschaft bekommen hat, sondern auch deshalb, weil das Land die zentral gesammelten Impfdaten direkt an Pfizer übermittelt und die Haftung für das Impfprodukt übernimmt. Ob Österreich bzw. die EU diesen Weg beschreiten hätte sollen, ist zumindest diskussionswürdig.
Freie Patente: Verpasste Chance?
Mehr Geld in die Impfstoffe und in die Pharmafirmen zu investieren, ist ein Ansatz. Im Angesicht des weltweiten Impfstoffmangels ist aber auch eine weitere Strategie, die Krise zu verkürzen, ins Auge zu fassen: die Freigabe der Impfstoff-Patente. Die im Lieferstreit mit AstraZeneca von der EU angedachten Maßnahmen, wie Vertragsstrafen oder Exportverbote, hätten auf längere Sicht nur dazu beigetragen, den Impfstoff noch knapper zu machen. Die Freigabe der Patente hingegen würde zu einer weltweiten Ausweitung der Impfstoffproduktion führen. Während nämlich derzeit die Entwickler-Unternehmen – aufgrund der drohenden Überkapazitäten nach der Krise – auf einen weiteren Ausbau der Produktion verzichten, liegen die Produktionsstätten anderer Pharmaunternehmen brach.
Ein marktkonformer Vorschlag zur Freigabe der Patente umfasst die Überführung der Impfstofflizenzen in Gemeingut gegen eine großzügige finanzielle Kompensation. Zwar müsste dafür kurzfristig mehr Geld in die Hand genommen werden, auf lange Sicht würde man sich durch die Verkürzung der Pandemie aber wahrscheinlich einiges an Kosten ersparen. Dass der Patentschutz nicht über dem Schutz von Menschenleben stehen darf, sollte als Maxime allgemeine Zustimmung hervorrufen. Dennoch konnte sich die weltweite Staatengemeinschaft bisher nicht dazu durchringen, mit der Freigabe der Impfstoff-Patente den Ausbau der Produktionskapazitäten anzuregen.
Dezentrales Malheur in Österreich
Dass Österreich bei der Impfstoffbeschaffung im Verbund mit 26 anderen Mitgliedsstaaten also nur eine Teilschuld trägt, konnte hinreichend gezeigt werden. Dennoch lohnt es, auch die österreichischen Versäumnisse genauer unter die Lupe zu nehmen.
Der Impfstoff ist nun also gekauft und alles unter Dach und Fach. Österreich macht sich an die Ausrollung. So zumindest die Hoffnung der Bevölkerung. Doch bereits zu Beginn gibt die Bundesregierung die Losung der „dezentralen Strukturen“ aus. Übersetzt bedeutet das: Vorbereitet hat man bundesweit nichts, man verlässt sich bei der Verimpfung auf die föderalen Strukturen. Während Deutschland bereits im November mit dem Aufbau zentraler Impfstraßen beginnt, ist man in Österreich guter Hoffnung, dass es über die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte schon funktionieren wird – und zwar mit dem zum damaligen Zeitpunkt noch nicht einmal zugelassenen Impfstoff von AstraZeneca. Auf den ist man nämlich angewiesen, wenn man auf dezentrale Strukturen setzt. Die weitaus wirksameren mRNA-Impfstoffe der Firmen Biontech/Pfizer und Moderna zu den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zu bringen, wäre logistisch zu aufwendig. Müssen diese doch bei -70 (Biontech/Pfizer) bzw. -30 (Moderna) Grad gelagert und anschließend in einem Zeitfenster von 120 Stunden (Biontech/Pfizer) bzw. 30 Tagen (Moderna) bei 2 bis 8 Grad an die Impfstelle geliefert werden.
In Großbritannien kennt man diese Probleme nicht, obwohl das Land nicht gerade für sein funktionsfähiges Gesundheitssystem bekannt ist. Das britische Gesundheitssystem ist im Unterschied zum österreichischen stark zentralisiert.
„Da gibt es eine Logistik, die für die Verbreitung der Ampullen sorgt. Da gibt es fachkundiges Personal, das das Know-How hat, wie man so eine Impfung setzt. All das ist eingespielt. […]“, so Thomas Spickhofen, ARD-Korrespondent in London.
Fehlende österreichische Impflogistik
Dass Österreich aufgrund logistischer Herausforderungen bei der Verteilung der mRNA-Impfstoffe zu stark auf den weniger wirksamen, dafür aber in der Handhabung einfacheren AstraZeneca-Impfstoff gesetzt habe, weist Gesundheitsminister Anschober mittlerweile zurück. Die meisten Dosen habe man mit 11,1 Millionen inzwischen vom Biontech/Pfizer-Impfstoff bestellt.
In Österreich hat man auf Basis der EU-Impfstoffverträge mit Stand 10. Februar folgende Impfstoffbestellungen getätigt:
Wie viele Nachbestellungen sich hinter der Summe von 11,1 Millionen Biontech/Pfizer-Impfstoff-Dosen verbergen und wann diese Dosen in Österreich eintreffen werden, hat Anschober allerdings nicht dazugesagt. Offen ließ er außerdem, wie die Impflogistik den veränderten Impfstoff-Gegebenheiten angepasst werden soll.
Sein Covid-Sonderbeauftragter Clemens Martin Auer ist jedenfalls vom österreichischen Weg der dezentralen Strukturen überzeugt. So kommentiert er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung:
„Mich haben in Österreich die Medien immer gefragt: Warum bauen wir nicht wie in Deutschland diese großen Impfzentren auf? Ich habe immer geantwortet: Wir machen nicht den gleichen Fehler, sondern setzen auf ein kleingliedriges, dezentrales System zum Impfen. Und jetzt flimmern jeden Abend in Deutschland in den Fernseh-Nachrichten Bilder von leeren Mega-Impfzentren. Das österreichische Fernsehen kann diese Bilder nicht machen, weil wir diese großen Impfzentren nicht haben – Gott sei Dank.“
Dass in Deutschland allerdings die Impfkampagne dank des Baus dieser Impfzentren volle Fahrt aufnehmen kann, sobald die Lieferengpässe behoben sind, während es in Österreich derzeit sowohl an Impfstoff als auch an Impflogistik mangelt, scheint Auer nicht weiter zu beunruhigen.
Ganz anders beurteilt Bernhard Wurzer, Generaldirektor der ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse), das Thema Impfzentren. Er berichtete am 21. Jänner in der ZiB 2, dass seitens der Gesundheitskasse 135 Einrichtungen und Gebäude zur Verfügung gestanden wären, in denen man Impfstraßen einrichten hätte können und wo auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte impfen hätten können, um der komplexen logistischen Herausforderung gerecht zu werden. Es wäre möglich gewesen, für die 7,2 Millionen Versicherten ein einheitliches Impfsystem inklusive Anmeldung zu errichten. Durch die Länder-Zuständigkeit gebe es nun neun unterschiedliche. Außerdem wären mit den Daten der Gesundheitskasse die Risikopatient*innen leicht festzustellen gewesen. Das Gesundheitsministerium habe die ÖGK aber nicht in die Umsetzung der Impfstrategie eingebunden. Man sei daher mit dem Angebot zur Unterstützung nun an die Länder herangetreten. Kärnten habe bereits Hilfe in Anspruch genommen, Tirol habe Interesse bekundet.
Fehlende Organisation und Intransparenz
Auf dezentrale Strukturen zu setzen, hat in Österreich Tradition, insbesondere im Gesundheitsbereich. So ist der Bund zwar für die Gesetzgebung zuständig, die Länder aber haben die Ausführung und Umsetzung über. Das Gesundheitsministerium hat sich dazu entschieden, diesen Weg auch in Zeiten der Corona-Pandemie zu verfolgen, anstatt die Kompetenzen an sich zu ziehen. Streng genommen kann man in Folge dessen auch nicht von einem Impfdesaster sprechen, sondern von maximal neun. So einfach aus der Verantwortung stehlen, kann sich der Bund dennoch nicht. Er bleibt nämlich für die Beschaffung, die Mengenkontingente, die Impfstrategie und den Transport zuständig. Und auch da hapert es.
Am Beginn des holprigen österreichischen Impfstarts standen zigtausende Impfdosen, die einer Auslieferung harrten. Von den ersten 63.000 gelieferten Impfdosen wurden nur 8.360 ausgeliefert. Warum der Rest über Tage und Wochen in den Lagern gebunkert wurde, konnte Chief Medical Officer im Gesundheitsministerium, Katharina Reich, nicht zufriedenstellend erklären. Den Verweis auf den gemeinsam vereinbarten Impfstart am 12. Jänner empfanden viele als unnötige Verzögerung.
Auch was Daten zu den Impfungen betrifft, war das Gesundheitsministerium lange säumig. Während in Deutschland von Beginn an tagesaktuelle Daten zu den Impfungen vorlagen, fehlten diese in Österreich und auch eine Aufschlüsselung auf die einzelnen Bundesländer gab es nicht. Dass dadurch der Eindruck entstand, der Bund wüsste gar nicht, wer, wo, wie viel Impfstoff bezieht, ist nicht verwunderlich. Auch den Vorwurf der Intransparenz musste sich das Gesundheitsministerium gefallen lassen. Zwei Monate nach dem Impfstart in Österreich gibt es mittlerweile zwar ein Dashboard des Gesundheitsministeriums, das die Zahl der ausgelieferten und der angeforderten Impfdosen sowie die Zahl der eingetragenen Impfungen im e-Impfpass angibt, was aber zwischen Auslieferung und Eintragung im Impfpass mit dem Impfstoff passiert, ist dem Ministerium unbekannt. Aufschlüsselungen nach Bezirken oder nach Gründen der Impfung (Alter, berufliche oder medizinische Gründe, Pflegeheimbewohner*in, etc.) fehlen daher. Außerdem befindet sich die Infrastruktur zur Implementierung des e-Impfpasses derzeit noch im Aufbau, sodass die Einmeldequote noch nicht bei 100 Prozent liegt.
Einen weiteren Imageschaden musste das Gesundheitsministerium einstecken, als sich mehrere Länderchefs darüber beschwerten, sie hätten keine Übersicht über die Impfungen in ihren Ländern, da die Pflegeeinrichtungen und Spitalsträger die Impfstoffe direkt bei der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) bestellen würden. Daraufhin wurde zwar beschlossen, dass die Bestellungen künftig bei den Ländern zusammenlaufen, das Bild eines unprofessionellen Impfstarts in Österreich verfestigte sich durch diese Organisationspanne allerdings noch.
Die vergebliche Suche nach verlässlichen Auskünften
Bei der veröffentlichten Impfstrategie hat sich das Gesundheitsministerium ebenfalls nicht mit Ruhm bekleckert. Vergeblich suchte man nach verlässlichen und verständlichen Auskünften darüber, wer wann zur Impfung drankomme und wo man sich anmelden kann. Auch hier steht Österreich der Föderalismus im Weg. Jedes Bundesland verfolgt diesbezüglich eine eigene Strategie. Während in Wien bereits am 18. Jänner eine Anmeldeplattform online ging, begann die Registrierung in Tirol erst im Februar und die ersten 10.000 Termine für über 80-Jährige in Niederösterreich konnten am 10. Februar gebucht werden.
Dieses uneinheitliche Vorgehen kritisiert Gerald Bachinger, niederösterreichischer Patient*innen- und Pflegeanwalt, scharf. Am 11. Februar beklagt er in der ZiB 2, dass bei der Terminvergabe in Niederösterreich ein „First-Come/First-Serve“ Prinzip herrsche und es keine einheitlichen Vorgaben des Bundes an die Länder gebe. Außerdem sprach er sich für eine Zusammenarbeit mit den Krankenversicherungsträgern aus. Diese könne mit vorhandenen Daten die Hochrisiko-Patient*innen herausfiltern, direkt an sie herantreten und ihnen einen Impftermin anbieten.
Von den Dänen lernen
An diesem Beispiel wird erneut deutlich, warum Österreich vergleichsweise langsam beim Impfen vorankommt. Der Impfvorreiter Israel verfügt über ein umfassend digitalisiertes Gesundheitssystem, in dem Krankenakten digital und zentral gesammelt und analysiert werden können. Dies verschaffte dem Land bei der Terminvergabe zu den landesweiten Impfaktionen große Vorteile.
Innerhalb der EU ist Dänemark neben Malta Impfvorreiter. Aktuell sind bereits 6,87 Prozent der dänischen Bevölkerung gegen Corona geimpft. Der EU-Schnitt liegt bei 4,84, Österreich liegt bei 4,67 Prozent. Wie Israel setzt auch Dänemark auf zentral gespeicherte Daten der Patient*innen. Alle Menschen werden angeschrieben und können dann online ihren Impftermin in einem der 30 Impfzentren buchen.
Ein weiterer Grund für den dänischen Erfolg ist die Tatsache, dass Dänemark im Unterschied zu vielen anderen europäischen Ländern – darunter auch Österreich – zu Beginn nicht primär auf den AstraZeneca-Impfstoff gesetzt hat, sondern das Land für die Verimpfung des Biontech/Pfizer-Präparats gerüstet hat, etwa mit dem Aufbau von Kühlsystemen für die Lagerung des mRNA-Impfstoffes bei -70 Grad.
Auch auf die Lieferengpässe von Biontech/Pfizer haben die Behörden in Dänemark flexibel reagiert. So werden aus einer Ampulle sechs statt fünf Dosen Impfstoff herausgezogen und der Abstand der zwei Impfungen wurde von drei auf sechs Wochen ausgedehnt. Eine ähnliche Strategie verfolgt übrigens auch Großbritannien mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Die zweite Dosis des Impfstoffes wird erst nach drei Monaten, statt nach den empfohlenen drei Wochen, verabreicht, um kurzfristig mehr Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung zu haben. Eine Studie aus Oxford bestätigt die britischen Behörden nun in ihrem Handeln. Den Ergebnissen der Studie zufolge biete schon die erste Dosis des Impfstoffes zwölf Wochen lang Schutz und verringere die Übertragung um zwei Drittel.
Zentrale Vorgaben als Erfolgsschlüssel
Laut Gesundheitsminister Anschober seien die Gewinnung von sechs Impfdosen aus einer Ampulle und die Streckung des Impfintervalls im Rahmen des Genehmigungsbescheids in Österreich bereits Realität. Zu einer Vorreiterrolle in Sachen Impftempo reichen diese beiden Strategien allein aber offensichtlich nicht aus.
Wie man das Blatt auch dreht und wendet, fest steht, dass keine der weltweiten Impfvorreiter ihren Erfolg dem Setzen auf „dezentrale Strukturen“ verdanken – im Gegenteil: zentral gespeicherte Daten, zentrale Vorgaben und zentral organisierte Impfstellen mit zentral gesteuerter Impflogistik scheinen der Schlüssel zum Erfolg zu sein. Das zeigen Beispiele wie Israel, Großbritannien und Dänemark. In Österreich hat man darauf verzichtet, zentral zu planen, obwohl mit der Österreichischen Gesundheitskasse ein mächtiger Partner in Sachen Daten und Logistik zur Verfügung gestanden wäre. Und auch wenn einige Startschwierigkeiten nicht Österreich alleine betrafen und die Gründe dafür multifaktoriell sind, lassen die strategischen Pannen, die bereits in den ersten beiden Monaten der anlaufenden Impfkampagne entstanden sind, keine große Hoffnung auf eine reibungslos ablaufende Immunisierung der österreichischen Bevölkerung in den kommenden Monaten aufkeimen.
Corona-Impfungen in Europa
In der EU sind derzeit drei Impfstoffe gegen Corona zugelassen: der mRNA-basierte Impfstoff von Biontech/Pfizer, ein weiterer mRNA-basierter Impfstoff der Firma Moderna und der Vektorviren-Impfstoff von AstraZeneca.
Außerhalb der EU zugelassen sind darüber hinaus der russische Vektorviren-Impfstoff Sputnik V und ein chinesischer Impfstoff mit inaktivierten Viren von Sinopharm. Innerhalb Europas setzen das EU-Land Ungarn und Serbien derzeit auf den russischen Impfstoff Sputnik V.
Elf weitere Impfstoffe befinden sich bereits in der abschließenden Phase III der Studien. Das bedeutet, der Impfstoff wird an 10.000 – 60.000 Patient*innen erprobt und die Wirksamkeit dabei mit einem Placebo (Scheinmedikament) überprüft. Davon werden drei bereits von der EMA (Europäische Arzneimittel-Agentur) im Zuge einer so genannten „Rolling Review“ – vorgezogene Prüfung eines Teils der Zulassungsunterlagen noch während der Phase-III-Studien – überprüft: der Vektorviren-Impfstoff von Johnson&Johnson, der mRNA-basierte Impfstoff von CureVac sowie der Totimpfstoff von Novavax. Mit Johnson&Johnson und mit CureVac hat die EU bereits Verträge über den Ankauf von Impfstoff abgeschlossen, sofern sich die Präparate als wirksam erweisen. Mit Novavax wurden Mitte Dezember Sondierungsgespräche abgeschlossen.
Ungarn soll bereits einen Liefervertrag mit der Firma Sinovac Biotech, deren Impfstoff mit inaktivierten Viren derzeit in Brasilien in Phase III getestet wird, abgeschlossen haben.
45 weitere Impfstoffe befinden sich derzeit in Phase I und II der Studien, darunter ein Totimpfstoff von Sanofi, über den die EU bereits einen Vertrag abgeschlossen hat und ein Impfstoff mit inaktivierten Viren von Valneva, zu dem die Sondierungsgespräche mit der EU Mitte Jänner abgeschlossen wurden.